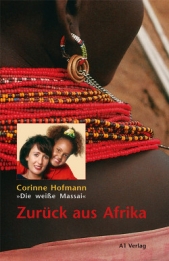Die weisse Massai
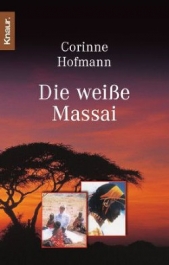
Die weisse Massai читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Er schleppt den Wagen zu unserem Haus und wil versuchen die Ersatzteile in Nairobi telefonisch zu bestel en.
Wenn die Inder in den nächsten Tagen mit dem Flugzeug kommen, könnten sie eventuel diese Teile mitbringen. Versprechen kann er im Moment nichts. Doch vier Tage später kommt er auf dem Motorrad dahergebraust und meldet, heute um elf Uhr würde das Flugzeug landen. Die Inder kämen, um den Bau der Schule zu kontrollieren. Ob es mit den Ersatzteilen geklappt habe, wisse er nicht.
Tatsächlich landet mittags das Flugzeug. Pater Giuliano fährt mit seinem Land-Cruiser zur provisorischen Piste, lädt die beiden Inder ein und fährt zum River. Ich schaue dem Wagen nach und sehe, daß Giuliano gleich weiterfährt, wahrscheinlich nach Wamba. Da ich nicht weiß, was los ist, entschließe ich mich, zur Schule hinüberzulaufen. Napirai bringe ich zur Mama.
Die beiden Inder mit Turban sehen mich überrascht an. Höflich werde ich mit Händedruck begrüßt, und mir wird eine Cola angeboten. Dann wollen sie wissen, ob ich zur Mission gehöre. Ich verneine und erkläre, daß ich hier lebe, denn ich sei die Frau eines Samburus. Jetzt schauen sie noch neugieriger, wie mir scheint, und wollen wissen, wie eine Weiße im Busch leben kann. Sie haben gehört, daß ihre Arbeiter große Verpflegungsschwierigkeiten haben. Ich erzähle von meinem Wagen, der leider defekt ist. Mitfühlend fragen sie, ob denn diese Kupplung für mich gewesen sei und nicht für die Mission. Ich bestätige ihre Vermutung und frage besorgt, ob es nicht geklappt habe. Nein, ist die niederschmetternde Antwort, da es verschiedene Model e gibt und nur anhand der ausgebauten Teile ersichtlich ist, welche benötigt werden. Meine Enttäuschung ist groß, was den beiden nicht entgeht. Der eine will wissen, wo mein Wagen steht. Dann beauftragt er den mitgebrachten Mechaniker, sich den Wagen anzuschauen und die Teile auszubauen. In einer Stunde fliegen sie zurück.
Der Mechaniker arbeitet schnell, und nach nur zwanzig Minuten weiß ich, daß die Kupplungsscheiben sowie die Gangschaltung völlig unbrauchbar sind. Er packt die schweren Teile zusammen, und wir fahren zurück. Der eine Inder schaut sich die ausgebauten Teile an und meint, in Nairobi sollte es möglich sein, Ersatz zu finden, doch es werde teuer. Die beiden beraten kurz und fragen unvermittelt, ob ich mitfliegen wil. Ich bin völlig überrumpelt und stammle, mein Mann sei nicht hier und außerdem hätte ich ein sechs Monate altes Kind zu Hause. Kein Problem, meinen sie, das Kind könne ich mitnehmen, sie hätten Platz für uns beide.
Im ersten Moment bin ich hin- und hergerissen und erwähne, daß ich mich in Nairobi absolut nicht auskenne. „No problem“,
sagt nun der andere Inder. Der Mechaniker kennt alle Ersatzteilhändler und werde mich morgen früh vom Hotel abholen und mit mir versuchen, gebrauchte Ersatzteile zu finden. Für mich als Weiße sei al es sowieso viel zu teuer.
Die überwältigende Hilfsbereitschaft dieser fremden Männer macht mich sprachlos.
Noch bevor ich weiter nachdenken kann, eröffnen sie mir, ich solle in einer Viertelstunde beim Flugzeug sein. „Yes, thank you very much“, stammle ich aufgeregt. Der Mechaniker fährt mich nach Hause. Schnel eile ich zur Mama und erkläre ihr, daß ich nach Nairobi fliege. Ich nehme Napirai und lasse die völlig verstörte Mama zurück. Im Haus packe ich die nötigsten Sachen für mein Baby und mich zusammen. Der Frau des Veterinärs erkläre ich meine Absicht und daß ich so schnel wie möglich mit den Ersatzteilen zurückkommen werde. Sie soll meinen Mann grüßen und erklären, warum ich nicht warten kann, um seine Erlaubnis einzuholen.
Dann eile ich zum Flugzeug. Napirai hängt im Kanga, und in einer Hand habe ich meine Reisetasche. Um das Flugzeug haben sich bereits viele neugierige Menschen versammelt, die bei meinem Anblick einen Moment verstummen. Die Mzungu fliegt weg, das ist eine Sensation, weil mein Mann nicht anwesend ist. Ich bin mir bewußt, daß es Probleme geben kann. Andererseits denke ich, er wird froh sein, wenn sein heißgeliebtes Auto wieder fährt und er nicht nach Nairobi muß.
Die Inder kommen in einem Arbeiterwagen, gerade als Mama mit wogenden Schritten und finsterem Gesicht erscheint. Sie gibt mir zu verstehen, ich sol e Napirai hier lassen, doch das kommt für mich nicht in Frage. Ich beruhige sie und verspreche wiederzukommen. Dann gibt sie mir und dem Kind doch noch den „Enkai“ mit auf den Weg. Wir steigen ein, und der Motor heult auf. Erschrocken springen die umstehenden Menschen auf die Seite. Ich winke allen zu, und schon rumpeln wir über die Piste.
Die Inder wol en vieles wissen. Wie ich zu meinem Mann kam, wieso wir hier in dieser Einöde leben. Ihr Staunen ruft bei mir ab und zu Heiterkeit hervor, und ich fühle mich froh und frei wie schon lange nicht mehr. Nach etwa eineinhalb Stunden erreichen wir Nairobi. Es ist wie ein Wunder für mich, in so kurzer Zeit die weite Strecke zurückgelegt zu haben. Nun fragen sie, wohin sie mich bringen sollen. Bei meiner Antwort, zum Igbol-Hotel in der Nähe des Odeon-Cinema, sind sie entsetzt und meinen, eine Lady wie ich gehöre nicht in diese Gegend, sie sei zu gefährlich.
Doch ich kenne nur dieses Quartier und bestehe darauf, dort abgeladen zu werden.
Der eine der Inder, offensichtlich der wichtigere von ihnen, steckt mir seine Visitenkarte zu, ich sol e morgen um neun Uhr anrufen, sein Chauffeur werde mich abholen. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht und bedanke mich überschwenglich.
Im Igbol kommen mir al mählich Zweifel, ob ich das al es bezahlen kann, denn ich habe gerade etwa 1000 Franken bei mir. Mehr Geld hatte ich nicht zu Hause und dieses auch nur, weil wir die Disco veranstaltet hatten. Ich wickle Napirai, und wir gehen hinunter ins Restaurant. Es ist schwierig, mit ihr am Tisch zu essen. Entweder reißt sie alles herunter oder will am Boden krabbeln. Seit sie das Krabbeln entdeckt hat, fegt sie in Windeseile über den Boden. Hier ist al es so schmutzig, daß ich sie nicht herunterlassen will. Aber sie zappelt und schreit so lange, bis sie ihren Willen durchsetzt. In kurzer Zeit steht sie vor Dreck, und die Einheimischen begreifen nicht, warum ich das zulasse. Dafür haben einige weiße Reisende ihre hel e Freude, wenn sie sich unter den Tischen durchzwängt. Sie ist jedenfalls zufrieden und ich auch.
Zurück auf dem Zimmer säubere ich sie gründlich im Waschbecken. Um selbst duschen zu können, muß ich warten, bis sie endlich eingeschlafen ist.
Am nächsten Tag regnet es in Strömen. Um halb neun stelle ich mich in die wartende Schlange vor den Telefonzellen. Wir sind naß bis auf die Knochen, als uns eine Frau vorläßt. Ich erreiche den Inder auf Anhieb und gebe ihm den Standort durch, Odeon Cinema. In zwanzig Minuten sei sein Chauffeur mit einem Wagen bei uns. Schnell renne ich ins Igbol zurück, um die Kleider zu wechseln. Mein Mädchen ist sehr tapfer. Sie weint nicht, obwohl sie völ ig durchnäßt ist. Beim Odeon Cinema erwartet uns der Chauffeur, und wir fahren in ein Industriegebiet, wo wir in ein feudales Büro geführt werden. Hinter dem Schreibtisch lächelt uns der nette Inder entgegen und fragt sofort, ob alles ohne Probleme verlaufen sei. Er telefoniert, und schon steht der afrikanische Mechaniker von gestern da. Er gibt ihm einige Adressen, die er mit uns abfahren sol, um die benötigten Ersatzteile zu suchen. Auf seine Frage, ob ich genügend Geld dabei habe, antworte ich: „I hope so!“
Wir fahren kreuz und quer durch Nairobi. Bis zum Mittag finden wir die Kupplungsteile für nur 150 Franken. Napirai und ich sitzen hinten im Wagen. Da der Regen aufgehört hat und die Sonne wieder scheint, wird es schnell heiß im Wagen.
Aber ich darf die Fenster nicht öffnen, da wir zum Teil in den übelsten Gegenden von Nairobi umherkurven. Der Fahrer versucht immer wieder sein Glück, doch er wird nicht fündig. Napirai schwitzt und heult. Sie hat genug vom Autofahren, und wir sind nun schon sechs Stunden ununterbrochen im Wagen, als der Mechaniker erklärt, es sei hoffnungslos, dieses Teil noch zu finden. Um fünf schließen heute al e Geschäfte, da morgen Karfreitag ist. Ostern habe ich völlig vergessen! Ahnungslos frage ich ihn, wann denn wieder geöffnet wird. Die Werkstätten seien bis Dienstag zu, ist die Antwort. Nun ergreift mich blankes Entsetzen, so lange allein mit Napirai in dieser Stadt bleiben zu müssen. Lketinga wird durchdrehen, wenn ich eine Woche fort bin.