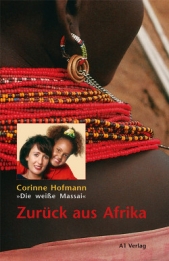Die weisse Massai
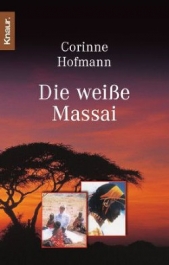
Die weisse Massai читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Wird alles gut?
Als wir in Nairobi landen, sind meine Nerven äußerst angespannt, weil ich nicht weiß, ob Lketinga am Flughafen sein wird. Wenn nicht, bin ich mit dem Gepäck und Napirai aufgeschmissen, die Lodgingsuche mitten in der Nacht wird schwierig werden. Wir verabschieden uns von den Stewardessen und begeben uns zur Paßkontrolle. Kaum bin ich durch, entdecke ich meinen Darling, James und dessen Freund. Meine Freude ist übergroß. Mein Mann hat sich wunderbar bemalt und seine langen Haare schön frisiert. Eingehüllt in die rote Decke steht er da. Voller Freude nimmt er uns in die Arme. Sofort fahren wir ins Lodging, das sie schon gebucht haben. Napirai hat mit den nun wieder schwarzen Gesichtern Schwierigkeiten, sie heult, und Lketinga ist besorgt, ob sie ihn überhaupt wiedererkennt.
Im Lodging wol en sie gleich die Geschenke sehen, doch ich packe nur die Uhren aus, da wir morgen weiter wollen und ich die Sachen geschickt verstaut habe. Die Burschen ziehen sich in ihr Zimmer zurück, und wir gehen ebenfal s ins Bett. In dieser Nacht schlafen wir miteinander, und es schmerzt nicht mehr. Glücklich hoffe ich, daß al es gut wird.
Auf dem Heimweg wird viel erzählt, und ich erfahre, daß in Barsaloi schon bald eine richtige, große Schule gebaut werden sol. Es kam ein Flugzeug von Nairobi mit Indern, die ein paar Tage in der Mission wohnten. Auf der anderen Seite des großen Rivers sol die Schule entstehen. Es werden viele Arbeiter von Nairobi kommen, alles Kikuyus.
Aber noch weiß niemand, wann es losgeht. Ich erzähle von der Schweiz und natürlich von der Krätze, da sich mein Mann ebenfalls behandeln lassen muß, sonst steckt er uns wieder an.
Lketinga ist mit dem Wagen bis nach Nyahururu gekommen und hat ihn bei der Mission abgestel t. Ich staune über seinen Mut. So erreichen wir Maralal problemlos, obwohl mir die Entfernungen wieder unendlich groß vorkommen. In Barsaloi treffen wir am nächsten Tag ein. Mama begrüßt uns glücklich und dankt Enkai, daß wir gesund vom „Eisenvogel“, wie sie das Flugzeug nennt, zurück sind. Es ist schön, zu Hause zu sein.
Auch in der Mission werde ich freudig begrüßt. Auf die Frage, was es mit dieser Schule auf sich hat, bestätigt Pater Giuliano, was mir die Burschen berichteten. In der Tat beginnt in den nächsten Tagen der Bau. Es sind schon einige Leute hier, die Baracken als Unterkunft für die Arbeiter bauen. Lastwagenweise kommt das Material über Nanyuki-Wamba hierher. Ich bin sprachlos, daß hier ein solches Projekt verwirklicht wird. Pater Giuliano erklärt mir, die Regierung wolle die Massai seßhaft machen. Die Lage ist nicht schlecht, weil der Fluß immer Wasser führt und genügend Sand vorhanden ist, um verbunden mit Zement Steine zu machen. Wegen der modernen Mission hat sich die Regierung für diesen Standort entschieden. Wir erleben herrliche Tage und spazieren immer wieder auf die andere Seite des Flusses, um das Geschehen zu verfolgen.
Meine Katze ist schon viel größer geworden. Offensichtlich hat Lketinga sein Versprechen gehalten und sie gefüttert, anscheinend nur mit Fleisch, denn sie ist wild wie ein Tiger. Nur wenn sie sich zu Napirai ins Bettchen legt, schnurrt sie wie eine zahme Hauskatze.
Nach gut zwei Wochen kommen die fremden Arbeiter. Am ersten Sonntag sind die meisten von ihnen in der Kirche anzutreffen, denn die Messe ist die einzige Abwechslung für die Städter. Die Somalis haben ihre Preise für Zucker und Mais drastisch erhöht, was zu großen Debatten und einer Dorfversammlung mit den Alten und dem Mini-Chief führt. Auch wir sind dabei, und ich werde oft gefragt, wann endlich der Samburu-Shop wieder geöffnet wird. Einige der Arbeiter sind anwesend und fragen, ob ich nicht bereit wäre, mit meinem Wagen Bier und Sodas zu organisieren. Sie würden mich gut bezahlen, da sie viel Geld verdienen, aber nichts ausgeben können. Die Somalis verkaufen als Moslems kein Bier.
Als auch abends ständig Arbeiter bei uns aufkreuzen, überlege ich tatsächlich, etwas zu unternehmen, damit wieder Geld verdient wird. Mir kommt die Idee, eine Art Disco mit Kikuyu-Musik zu organisieren. Dazu könnten wir Fleisch grillen sowie Bier und Soda verkaufen. Ich bespreche alles mit Lketinga und dem Veterinär, bei dem sich mein Mann öfter aufhält. Beide sind von der Idee begeistert, und der Veterinär meint, es sollte auch Miraa angeboten werden, da die Leute ständig nach dem Kraut fragen. Schon ist es beschlossene Sache, daß wir den Versuch Ende des Monats starten. Ich reinige den Shop und schreibe Flugblätter, die wir an verschiedenen Orten aufhängen und bei den Arbeitern abgeben.
Das Echo ist gewaltig. Bereits am ersten Tag kommen einige Leute und fragen, warum wir nicht schon am Wochenende starten. Doch das ist zu kurzfristig, da es obendrein manchmal kein Bier in Maralal gibt. Wir machen unsere übliche Tour und kaufen zwölf Kästen Bier und Sodawasser. Mein Mann organisiert Miraa. Der Wagen ist randvol, und die Rückfahrt dauert entsprechend länger.
Daheim stapeln wir die Waren vorne im Shop, da in unserer ehemaligen Wohnung die Tanzfläche sein wird. Nach kurzer Zeit stehen die ersten da und wollen Bier kaufen. Ich bleibe eisern, da wir sonst morgen nichts mehr haben. Dann kommt der Mini-Chief und verlangt von mir die Lizenz für eine Disco. Natürlich habe ich keine und frage ihn, ob das wirklich nötig sei. Lketinga bespricht sich mit ihm. Er will morgen, gegen Entschädigung natürlich, für Ordnung sorgen. Für etwas Geld und Gratisbier erläßt er die Lizenz.
Heute soll die Disco stattfinden, und wir sind sehr gespannt. Der Shop-Helfer versteht etwas von Technik. Er nimmt die Batterie aus dem Wagen, um sie am Kassettenrecorder anzuschließen. Der Sound ist da. Inzwischen wurde eine Ziege geschlachtet. Zwei Boys sind mit dem Ausnehmen und Zerlegen beschäftigt. Viele Freiwil ige helfen mit, nur Lketinga ist mehr mit Delegieren als mit persönlichem Einsatz beschäftigt, und um halb acht ist al es bereit. Die Musik läuft, das Fleisch brutzelt, und die Leute warten am Hintereingang. Lketinga kassiert den Eintritt von den Männern, die Frauen haben freien Zugang. Doch sie bleiben draußen und schauen nur ab und zu kichernd durch den Eingang. Innerhalb einer halben Stunde ist der Shop voll. Immer wieder stellen sich Arbeiter vor und gratulieren mir zu dieser Idee. Sogar der Bauführer kommt und dankt für meine Bemühungen. Die Leute haben eine Abwechslung verdient, denn für viele ist es die erste weit abgelegene Baustelle.
Mir gefäl t es gut, mitten unter so vielen fröhlichen Menschen zu sein, und die meisten sprechen Englisch. Es kommen auch Samburus aus dem Dorf und sogar ein paar Alte, die sich auf umgekippte Kästen setzen und, in ihre Wol decken gehüllt, den tanzenden Kikuyus zusehen. Ihr Staunen ist grenzenlos. Ich selbst tanze nicht, obwohl ich Napirai bei der Mama gut untergebracht habe. Einige wol en mich zum Tanzen auffordern, aber ein Blick zu Lketinga rät mir, dies zu unterlassen. Er trinkt hinten heimlich sein Bier und kaut Miraa. Dieses ist als erstes ausverkauft.
Um 23 Uhr wird die Musik leise, und einige Männer halten eine Dankesrede auf uns, insbesondere auf mich, die Mzungu. Eine Stunde später geht das letzte Bier weg. Auch die Ziege wurde kiloweise verkauft. Die Gäste sind in guter Stimmung, die bis vier Uhr nachts anhält. Dann endlich gehen wir nach Hause. Ich hole Napirai bei der Mama ab und stapfe erschöpft zu unserer Hütte hinunter.
Beim Zählen unserer Einnahmen stelle ich am nächsten Tag erfreut fest, daß die Gewinne wesentlich höher sind als mit dem Shop. Die Freude ist allerdings schnel getrübt, als Pater Giuliano auf seinem Motorrad heranbraust und ärgerlich fragt, was das für ein „Saulärm“ letzte Nacht in unserem Shop gewesen sei. Kleinlaut erzähle ich von der Disco. Grundsätzlich stört es ihn nicht, wenn es bei zweimal im Monat bleibt, doch nach Mitternacht wil er seine Nachtruhe. Da ich ihn nicht verärgern will, muß ich mich bei einer Wiederholung daran halten.