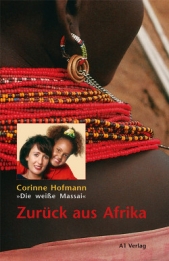Die weisse Massai
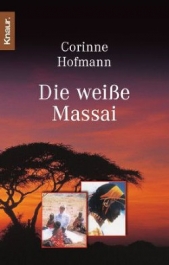
Die weisse Massai читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Er händigt mir den Kinderausweis aus und wünscht al es Gute. Auf meine Frage, ob ich nun ausreisen könne, weist er darauf hin, daß jetzt noch die kenianische Behörde einen Aus- und Einreisestempel geben müsse, und dafür brauche ich ebenfal s die Genehmigung des Vaters. Mir schwant schon die nächste Aufregung.
Mürrisch verlassen wir die Botschaft und gehen ins Nyayo-Gebäude. Wieder müssen wir Formulare ausfüllen und warten.
Napirai schreit und läßt sich auch durch die Brust nicht beruhigen. Wieder sind wir Zielscheibe vieler Blicke, wieder tuscheln einige über die Aufmachung meines Mannes. Endlich werden wir aufgerufen. Abschätzig fragt die Frau hinter der Glasscheibe meinen Mann, warum Napirai einen deutschen Ausweis habe, wenn sie doch in Kenia geboren wurde. Alles beginnt von neuem, und ich unterdrücke wütend meine Tränen. Der arroganten Dame erkläre ich, daß mein Mann keinen Paß besitzt, obwohl er ihn bereits vor zwei Jahren beantragt hat. Deshalb kann unsere Tochter dort auch nicht eingetragen werden. Wegen meiner schlechten Gesundheit aber müsse ich zur Erholung in die Schweiz. Die nächste Frage haut mich fast um: Warum ich denn das Baby nicht beim Vater lassen will? Empört erkläre ich, daß es doch normal sei, ein dreimonatiges Kind mitzunehmen. Außerdem hätte meine Mutter wohl das Recht, ihr Enkelkind zu sehen! Endlich drückt sie den Stempel auf das Ausweispapier. Auch mein Paß wird abgestempelt. Erschöpft und erleichtert raffe ich die Pässe zusammen und stürze aus dem Office.
Nun muß ich ein Ticket buchen. Diesmal habe ich den Nachweis, woher das Geld stammt, dabei. Ich lege die Pässe vor, und wir buchen einen Flug, der in zwei Tagen startet. Es dauert nicht lange, bis die Angestellte mit den ausgestellten Tickets zurückkommt. Sie zeigt mir die Flugscheine und liest laut „Hofmann, Napirai“ und
„Hofmann, Corinne“. Aufgebracht fragt Lketinga erneut, warum wir überhaupt geheiratet haben, wenn ich gar nicht seine Frau sei! Auch sein Kind gehöre wahrscheinlich gar nicht ihm. Nun bin ich mit meinen Nerven am Ende. Ich heule vor Scham, stecke die Tickets ein, und wir verlassen das Office, um ins Lodging zurückzukehren.
Mein Mann beruhigt sich al mählich. Verstört und traurig sitzt er auf dem Bett, und irgendwie verstehe ich ihn. Für ihn ist der Familienname das höchste Geschenk, was man seiner Frau und seinen Kindern geben kann, und ich nehme es nicht an. Das bedeutet für ihn, daß ich nicht zu ihm gehören will. Ich fasse ihn bei der Hand und rede ihm gut zu, daß er sich wirklich keine Sorgen machen muß, wir werden wiederkommen. Ich werde ein Telegramm an die Mission senden, damit er weiß, an welchem Tag. Er erklärt mir, er fühle sich einsam ohne uns, aber er wil auch endlich wieder eine gesunde Frau haben. Wenn wir wiederkommen, will er uns am Flughafen abholen. Diese Abmachung erfüllt mich mit Freude, denn mir ist klar, welch eine Überwindung ihn diese Reise kosten wird. Zum Schluß teilt er mir mit, daß er nun Nairobi verlassen will, um nach Hause zu fahren. Die Warterei hier mache ihn nur unglücklich. Ich verstehe das, und wir begleiten ihn zur Busstation.
Wir stehen da und warten auf die Abfahrt. Noch einmal fragt er besorgt: „Corinne, my wife, you are sure, you and Napirai come back to Kenya?“
Lachend erwidere ich: „Yes, darling, I'm sure.“
Dann fährt sein Bus ab.
Erst vorgestern habe ich meiner Mutter telefonisch unseren Besuch ankündigen können. Sie war natürlich überrascht, freut sich aber sehr, endlich ihr Enkelkind zu sehen. Deshalb will ich mein Baby und mich selber hübsch machen. Doch es ist schwer, mit so einem kleinen ungestümen Kind das Zimmer zu verlassen. Die Toiletten und Duschen liegen hinten im Gang. Wenn ich die Toilette benutze, muß ich sie wohl oder übel mitnehmen, falls sie nicht gerade schläft. Beim Duschen jedoch geht das schlecht. Ich gehe zur Rezeption und frage die Frau, ob sie eine Viertelstunde auf mein Baby achtet, damit ich duschen kann. Sie würde das gerne tun, doch im Moment habe halb Nairobi kein Wasser wegen eines Rohrbruchs, aber vielleicht funktioniere die Leitung am Abend wieder.
Bis sechs Uhr warte ich, aber es geschieht nichts. Im Gegenteil, überall stinkt es bereits. Ich will nicht länger warten, weil ich um zehn Uhr am Flughafen sein muß, gehe in einen Shop und schleppe einige Liter Mineralwasser in mein Zimmer. Erst wasche ich Napirai, dann meine Haare und notdürftig den Körper.
Ein Taxi bringt uns zum Flughafen. Unser Reisegepäck ist spärlich, obwohl Ende November die Temperaturen in Europa eher winterlich sein werden. Die Stewardessen geben sich viel Mühe mit uns, und immer wieder bleiben sie bei meinem kleinen Mädchen stehen und schwatzen ein paar Worte. Nach dem Essen bekomme ich ein Babybett für sie, und kurz darauf schläft sie. Auch mich übermannt die Müdigkeit. Als ich wieder geweckt werde, gibt es bereits Frühstück. Bei dem Gedanken, bald auf Schweizer Boden zu stehen, werde ich unruhig.
Weiße Gesichter
Mein Baby binde ich im Tragetuch auf den Rücken, und wir passieren problemlos die Paßkontrol e. Da entdecke ich meine Mutter und Hanspeter, ihren Mann. Die Freude ist groß. Napirai schaut interessiert in die weißen Gesichter.
Auf der Fahrt ins Berner Oberland sehe ich meiner Mutter an, daß ihr mein Anblick Sorgen macht. Zu Hause nehmen wir als erstes ein Bad, endlich ein heißes Bad!
Meine Mutter hat eine kleine Badewanne für Napirai besorgt und übernimmt diese Arbeit. Als ich ungefähr zehn Minuten im heißen Wasser sitze, juckt es mich am ganzen Körper. Meine wunden Stel en an den Beinen und den Armen sind offen und eitern. Diese Verletzungen sind durch meinen Massai-Schmuck entstanden und heilen in dem feuchten Klima schlecht. Ich steige aus der Badewanne und sehe meinen Körper übersät mit roten Flecken. Napirai schreit bei der verzweifelten Großmutter. Sie ist ebenfalls voller roter Pusteln. Es juckt fürchterlich. Da meine Mutter etwas Ansteckendes befürchtet, melden wir uns für den nächsten Tag bei einem Hautarzt an.
Er ist erstaunt, als er unsere Krankheit erkennt: Krätze. Das ist in der Schweiz eine seltene Krankheit. Es sind Milben unter der Haut, die sich bei großer Hitze weiterbewegen, was den extremen Juckreiz verursacht. Natürlich wundert sich der Arzt, woher wir diese Krankheit haben. Ich erzähle von Afrika. Als er auch noch meine Wunden entdeckt, die sich schon bis zu einem Zentimeter ins Fleisch gefressen haben, schlägt er mir vor, einen Aids-Test zu machen. Mir bleibt im ersten Moment die Luft weg, aber ich bin bereit. Er gibt mir mehrere Flaschen mit einer Flüssigkeit mit, die wir täglich dreimal gegen die Krätze auftragen müssen und sagt, ich solle mich wegen der Testergebnisse in drei Tagen melden. Diese Tage des Wartens sind schlimmer als al es Bisherige.
Den ersten Tag schlafe ich viel und gehe früh mit Napirai zu Bett. Am zweiten Tag klingelt abends das Telefon, und ich werde vom Arzt persönlich verlangt. Mir dröhnt der Puls, als ich den Hörer, aus dem die Antwort über mein weiteres Schicksal kommen wird, entgegennehme. Der Arzt entschuldigt sich für den späten Anruf, möchte mir aber das Warten erleichtern und teilt mit, der Test sei negativ ausgefal en. Ich bin unfähig, mehr als danke! zu sagen, fühle mich aber wie neu geboren, und eine große Kraft durchströmt meinen Körper. Jetzt weiß ich, daß ich auch die Folgen der Hepatitis besiegen werde. Täglich steigere ich meinen Fettkonsum ein wenig und esse alles, was meine Mutter mir zuliebe kocht.
Die Zeit vergeht langsam, da ich mich hier doch nicht zu Hause fühle. Wir unternehmen viele Spaziergänge, besuchen meine Schwägerin Jelly und wandern mit Napirai in den ersten Schnee. Ihr gefällt das Leben hier sehr gut, nur das ständige An- und Ausziehen der vielen Kleider mag sie nicht.
Nach zweieinhalb Wochen ist mir klar, daß ich nicht länger als bis Weihnachten bleiben will. Doch der erste Flug, den ich bekommen kann, geht erst am fünften Januar 1990. So bin ich doch fast sechs Wochen weg von daheim. Der Abschied fällt mir schwer, weil ich nun wieder auf mich allein gestel t sein werde. Mit fast vierzig Kilo Gepäck reise ich zurück. Für alle habe ich etwas gekauft oder genäht. Meine Familie hat vieles mitgegeben, und Napirais Weihnachtsgeschenke mußte ich auch noch einpacken. Mein Bruder hat ein Huckepack-Gestell für sie gekauft.