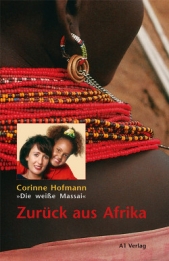Die weisse Massai
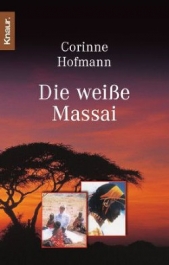
Die weisse Massai читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Mein Mann müsse sich ebenfalls schnellstens untersuchen lassen. Nach diesen niederschmetternden Informationen schwirrt mein Kopf. Zwei schwarze Schwestern kommen mit dem Rol stuhl, und ich werde mit al meinen Sachen in einen neuen Trakt des Spitals verlegt. Ich bekomme ein Zimmer mit WC, das vorne eine Glasfront, aber keine Tür hat. Von innen kann man den Raum nicht öffnen. In der Tür gibt es eine Luke, die für die Essensausgabe geöffnet wird. Der Trakt ist neu, und das Zimmer sieht freundlich aus, doch ich fühle mich schon jetzt als Gefangene.
Unsere Sachen werden zum Desinfizieren mitgenommen, und ich bekomme wieder die Spital-Uniform. Jetzt wird auch Napirai untersucht. Als man ihr Blut abzapft, schreit sie natürlich wie am Spieß. Mir tut sie unendlich leid, sie ist noch so klein, gerade sechs Wochen alt, und muß schon so viel leiden. Ich werde an eine Infusion gehängt und bekomme einen Krug mit Wasser, das mit einem halben Kilo Zucker gesüßt ist. Ich muß viel Zuckerwasser trinken, denn damit kann sich die Leber am schnellsten erholen. Dann brauche ich Ruhe, absolute Ruhe. Das ist alles, was man für mich tun kann. Mein Baby nehmen sie mit. Verzweifelt weine ich mich in den Schlaf.
Bei hellem Sonnenschein werde ich wach und weiß nicht, wie spät es ist. Die Totenstille versetzt mich in Panik. Man hört absolut nichts, und wenn ich Kontakt nach draußen wil, muß ich klingeln. Daraufhin erscheint eine schwarze Schwester hinter der Glasscheibe, die mich durch die gelöcherte Luke anspricht. Ich will wissen, wie es Napirai geht. Sie wird die Ärztin holen. Es vergehen Minuten, die mir in dieser Stille wie eine Ewigkeit vorkommen. Dann betritt die Ärztin mein Zimmer. Ich frage erschrocken, ob sie sich denn nicht anstecken würde. Lächelnd beruhigt sie mich:
„Einmal Hepatitis, nie mehr Hepatitis!“ Sie hatte die Krankheit selbst schon vor Jahren.
Dann erhalte ich endlich eine gute Nachricht. Napirai ist völlig gesund, nur will sie absolut keine Kuhmilch oder Pulvermilch trinken. Mit zittriger Stimme frage ich, ob ich sie nun die ganzen sechs Wochen nicht mehr halten darf. Wenn sie die andere Nahrung bis morgen nicht akzeptiert, muß ich sie wohl oder übel stillen, obwohl die Ansteckungsgefahr enorm groß ist, erklärt die Ärztin. Ohnehin sei es ein Wunder, daß sie noch nicht infiziert ist.
Gegen fünf Uhr bekomme ich mein erstes Essen, Reis mit Kohl aus dem Wasser gezogen, dazu eine Tomate. Ich esse langsam. Diesmal behalte ich die kleine Portion bei mir, aber die Schmerzen kommen wieder, wenn auch nicht so stark.
Napirai wird mir zweimal an der Scheibe gezeigt. Mein Mädchen schreit, und ihr Bäuchlein ist richtig hohl. Am nächsten Mittag bringen mir die entnervten Schwestern mein kleines, braunes Bündelchen. Mich durchströmt ein tiefes Glücksgefühl, wie ich es schon lange nicht mehr empfunden habe. Gierig sucht sie nach meiner Brust und beruhigt sich beim Saugen. Beim Betrachten meiner Napirai wird mir klar, daß ich sie brauche, wenn ich die notwendige Ruhe und den Willen finden soll, diese Isolation zu überstehen. Während des Trinkens schaut sie mich mit ihren großen dunklen Augen unverwandt an und ich muß mich zusammenreißen, damit ich sie nicht zu fest an mich drücke. Als die Ärztin später vorbeischaut, sagt sie: „Ich sehe, ihr beiden braucht einander, um gesund zu werden oder es zu bleiben!“ Endlich kann ich wieder lächeln und verspreche ihr, mir Mühe zu geben.
Täglich würge ich bis zu drei Liter extrem süßes Wasser hinunter, wobei ich mich fast übergeben muß. Da ich nun auch Salz bekomme, schmeckt das Essen etwas besser. Zum Frühstück gibt es Tee und eine Art Knäckebrot mit einer Tomate oder einer Frucht, zum Mittag- und Abendessen immer dasselbe: Reis mit oder ohne Kohl direkt aus dem Wasser gezogen. Alle drei Tage werden mir zur Untersuchung Blut und Urin abgenommen. Nach einer Woche fühle ich mich bereits besser, wenngleich noch sehr schwach.
Zwei Wochen später kommt der nächste Schlag. Am Urin haben sie festgestellt, daß meine Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Ich hatte zwar Schmerzen im Kreuz, die ich aber auf das ewige Liegen zurückgeführt habe. Nun bekomme ich auch kein Salz mehr in das ohnehin fade Essen. Dafür wird mir ein Beutel für den Urin angeschlossen, was sehr schmerzhaft ist. Nun muß ich täglich aufschreiben, wieviel ich trinke, und die Schwester mißt anhand des Beutels, was wieder herauskommt.
Da hatte ich endlich wieder Kraft für ein paar Schritte und bin nun von neuem ans Bett gefesselt! Wenigstens ist Napirai bei mir. Ohne sie hätte ich sicher keine Freude mehr am Leben. Sie muß spüren, daß es mir nicht gut geht, denn seit sie bei mir ist, weint sie nicht mehr.
Mein Mann ist zwei Tage nach meiner Einlieferung zur Untersuchung ins Spital gekommen. Er ist gesund und hat sich die letzten zehn Tage nicht mehr gezeigt.
Mein Anblick damals war sicher nicht sehr erfreulich, und sprechen konnten wir nicht miteinander. Er stand traurig vor dem Glasfenster und ging dann eine halbe Stunde später wieder. Ab und zu bekomme ich Grüße von ihm. Wir fehlen ihm sehr, und um die Zeit herumzukriegen, ist er dauernd mit unserer Herde unterwegs, wird mir mitgeteilt. Seit in Wamba bekannt ist, daß eine Mzungu im Spital liegt, stehen regelmäßig fremde Besucher vor der Scheibe und starren das Baby und mich an.
Manchmal sind es bis zu zehn Personen. Mir ist es jedesmal peinlich, und ich ziehe das Bettlaken über den Kopf.
Die Tage schleppen sich dahin. Entweder spiele ich mit Napirai oder lese Zeitung.
Nun bin ich schon zweieinhalb Wochen hier und habe während dieser Zeit weder einen Sonnenstrahl noch frische Luft gespürt. Auch das Gezirpe der Grillen und das Zwitschern der Vögel vermisse ich sehr. Langsam überkommt mich eine Depression.
Ich denke viel über mein Leben nach und fühle deutlich, daß mein Heimweh Barsaloi und dessen Bewohnern gehört.
Wieder naht die Besuchszeit, und ich verkrieche mich unter die Decke, als eine Schwester mir mitteilt, Besuch sei für mich da. Ich luge hervor und sehe meinen Mann mit einem anderen Krieger an der Scheibe. Glücklich strahlt er Napirai und mich an. Sein fröhlicher, schöner Anblick versetzt mich augenblicklich in eine seit langem nicht mehr verspürte Hochstimmung. So gerne würde ich jetzt auf ihn zugehen, ihn berühren und sagen: „Darling, no problem, everything becomes okay.“
Statt dessen halte ich Napirai so, daß er seine Tochter von vorne sieht und zeige auf ihren Papa. Sie strampelt und fuchtelt lustig mit ihren fetten Beinchen und Ärmchen. Als Fremde wieder versuchen, durch die Scheibe zu spähen, sehe ich, wie mein Mann die Leute einschüchtert, und sie schleichen davon. Ich muß lachen, und auch er unterhält sich lachend mit seinem Freund. Sein geschmücktes Gesicht glänzt im Sonnenschein. Ach, ich liebe ihn trotz allem noch immer! Die Besuchszeit ist zu Ende, und wir winken uns zu. Der Besuch meines Mannes gibt mir die nötige Kraft, mich psychisch zu fangen.
Nach der dritten Woche wird mir der Urinbeutel entfernt, da die Werte nun bedeutend besser sind. Endlich kann ich mich richtig waschen, sogar duschen. Bei der Visite staunt die Ärztin, wie hübsch ich mich gemacht habe. Meine Haare sind durch ein rotes Band zu einem Pferdeschwanz hochgebunden, und ich habe Lippenstift aufgetragen. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Als sie mir eröffnet, daß ich in einer Woche für eine Viertelstunde nach draußen gehen darf, bin ich glücklich. Ich zähle die Tage, bis es soweit ist.
Die vierte Woche ist vorbei, und ich darf meinen Käfig mit meiner Tochter auf dem Rücken verlassen. Mir verschlägt es fast den Atem bei der tropischen Luft, die ich gierig einsauge. Wie wunderbar die Vögel singen und wie gut diese roten Büsche riechen, nehme ich jetzt überdeutlich wahr, nachdem mir dies al es für einen Monat verwehrt war. Am liebsten möchte ich jauchzen vor Freude.
Da ich mich nicht vom Trakt entfernen soll, laufe ich ein paar Meter an den anderen Scheiben entlang. Was sich hinter ihnen auftut, ist schrecklich. Fast alle Kinder haben Mißbildungen. Manchmal stehen bis zu vier Bettchen in einem Raum.