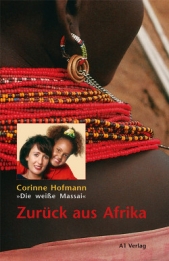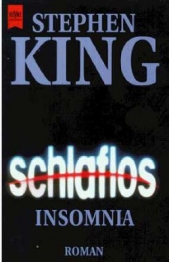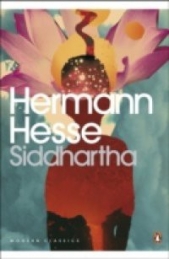Ansichten eines Clowns

Ansichten eines Clowns читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
»Suchen Sie sich wieder so eine treue Seele«, sagte er, »wie das Mädchen, das mit Ihnen gereist ist.«
»Treue Seele«, sagte ich.
»Ja«, sagte er, »alles andere ist Quatsch. Und bilden Sie sich nicht ein, Sie könnten ohne mich fertig werden und in miesen Vereinen herumtingeln. Das geht drei Wochen gut, Schnier, da können Sie bei Feuerwehrjubiläen ein bißchen Unsinn machen und mit dem Hut rumgehen. Sobald ichs erfahre, schnüre ich Ihnen das alles ab.«
»Sie Hund«, sagte ich.
»Ja«, sagte er, »ich bin der beste Hund, den Sie finden können, und wenn Sie anfangen, auf eigne Faust tingeln zu gehen, sind Sie in spätestens zwei Monaten vollkommen erledigt. Ich kenn das Geschäft. Hören Sie?«
Ich schwieg.
»Ob Sie hören?« fragte er leise.
»Ja«, sagte ich.
»Ich habe Sie gern. Schnier«, sagte er, »ich habe gut mit Ihnen gearbeitet — sonst würde ich nicht ein so kostspieliges Telefongespräch mit Ihnen führen.«
»Es ist sieben vorbei«, sagte ich, »und der Spaß kostet Sie schätzungsweise zwei Mark fünfzig.«
»Ja«, sagte er, »vielleicht drei Mark, aber im Augenblick würde kein Agent so viel an Sie legen. Also: in einem Vierteljahr und mit mindestens sechs tadellosen Nummern. Quetschen Sie aus Ihrem Alten soviel raus, wie Sie können. Tschüs.«
Er hing tatsächlich ein. Ich hielt den Hörer noch in der Hand, hörte das Tuten, wartete, legte nach langem Zögern erst auf. Er hatte mich schon ein paar Mal beschwindelt, aber nie belogen. Zu einer Zeit, wo ich wahrscheinlich zweihundertfünfzig Mark pro Abend wert gewesen wäre, hatte er mir Hundertachtzigmarkverträge besorgt — und wahrscheinlich ganz nett an mir verdient. Erst als ich aufgelegt hatte, wurde mir klar, daß er der erste war, mit dem ich gern noch länger telefoniert hätte. Er sollte mir irgendeine andere Chance geben — als ein halbes Jahr warten. Vielleicht gab es eine Artistengruppe, die jemand wie mich brauchte, ich war nicht schwer, schwindelfrei und konnte nach einigem Training ganz gut ein bißchen Akrobatik mitmachen, oder mit einem anderen Clown zusammen Sketche einstudieren. Marie hatte immer gesagt, ich brauche ein »Gegenüber«, dann würden mir die Nummern nicht so langweilig. Zohnerer hatte bestimmt noch nicht alle Möglichkeiten bedacht. Ich beschloß, ihn später anzurufen, ging ins Badezimmer zurück, warf den Bademantel ab, die übrigen Kleider in die Ecke und stieg in die Wanne. Ein warmes Bad ist fast so schön wie Schlaf. Unterwegs hatte ich immer, auch als wir noch wenig Geld hatten, Zimmer mit Bad genommen. Marie hatte immer gesagt, für diese Verschwendung sei meine Herkunft verantwortlich, aber das stimmt nicht. Zu Hause waren sie mit warmem Badewasser so geizig gewesen wie mit allem anderen. Kalt duschen, das durften wir jederzeit, aber ein warmes Bad galt auch zu Hause als Verschwendung, und nicht einmal Anna, die sonst ein paar Augen zudrückte, war in diesem Punkt umzustimmen gewesen. In ihrem I.R.9 hatte offenbar ein warmes Wannenbad als eine Art Todsünde gegolten.
Auch in der Badewanne fehlte mir Marie. Sie hatte mir manchmal vorgelesen, wenn ich in der Wanne lag, vom Bett aus, einmal aus dem Alten Testament die ganze Geschichte von Salomon und der Königin von Saba, ein anderes Mal den Kampf der Machabäer, und hin und wieder aus Schau heimwärts, Engel von Thomas Wolfe. Jetzt lag ich vollkommen verlassen in dieser dummen, rostroten Badewanne, das Badezimmer war schwarzgekachelt, aber Wanne, Seifenschale, Duschengriff und Klobrille waren rostfarben. Mir fehlte Maries Stimme. Wenn ich es mir überlegte, konnte sie nicht einmal mit Züpfner in der Bibel lesen, ohne sich wie eine Verräterin oder Hure vorzukommen. Sie würde an das Hotel in Düsseldorf denken müssen, wo sie mir von Salomon und der Königin von Saba vorgelesen hatte, bis ich in der Wanne vor Erschöpfung einschlief. Die grünen Teppiche in dem Hotelzimmer, Maries dunkles Haar, ihre Stimme, dann brachte sie mir eine brennende Zigarette, und ich küßte sie.
Ich lag bis obenhin im Schaum und dachte an sie. Sie konnte gar nichts mit ihm oder bei ihm tun, ohne an mich zu denken. Sie konnte nicht einmal in seiner Gegenwart den Deckel auf die Zahnpastatube schrauben. Wie oft hatten wir miteinander gefrühstückt, elend und üppig, hastig und ausgiebig, sehr früh am Morgen, spät am Vormittag, mit sehr viel Marmelade und ohne. Die Vorstellung, daß sie mit Züpfner jeden Morgen um dieselbe Zeit frühstücken würde, bevor er in seinen Wagen stieg und in sein katholisches Büro fuhr, machte mich fast fromm. Ich betete darum, daß es nie sein würde: Frühstück mit Züpfner. Ich versuchte mir Züpfner vorzustellen: braunhaarig, hellhäutig, gerade gewachsen, eine Art Alkibiades des deutschen Katholizismus, nur nicht so leichtfertig. Er stand nach Kinkels Aussage »zwar in der Mitte, aber doch mehr nach rechts als nach links«. Dieses Links-und-rechts-stehen war eines ihrer Hauptgesprächsthemen. Wenn ich ehrlich war, mußte ich Züpfner zu den vier Katholiken, die mir als solche erschienen, hinzuzählen: Papst Johannes, Alec Guinness, Marie, Gregory — und Züpfner. Gewiß hatte auch bei ihm bei aller möglichen Verliebtheit die Tatsache eine Rolle gespielt, daß er Marie aus einer sündigen in eine sündenlose Situation rettete. Das Händchenhalten mit Marie war offenbar nichts Ernsthaftes gewesen. Ich hatte mit Marie später darüber geredet, sie war rot geworden, aber auf eine nette Art, und hatte mir gesagt, es »wäre viel zusammengekommen« bei dieser Freundschaft: daß ihre Väter beide von den Nazis verfolgt gewesen wären, auch der Katholizismus, und »seine Art, weißt du. Ich hab ihn immer noch gern.« Ich ließ einen Teil des lau gewordenen Badewassers ablaufen, heißes zulaufen und schüttete noch etwas von dem Badezeug ins Wasser. Ich dachte an meinen Vater, der auch an dieser Badezeugfabrik beteiligt ist. Ob ich mir Zigaretten kaufe, Seife, Schreibpapier, Eis am Stiel oder Würstchen: mein Vater ist daran beteiligt. Ich vermute, daß er sogar an den zweieinhalb Zentimetern Zahnpasta, die ich gelegentlich verbrauche, beteiligt ist. Über Geld durfte aber bei uns zu Hause nicht gesprochen werden. Wenn Anna mit meiner Mutter abrechnen, ihr die Bücher zeigen wollte, sagte meine Mutter immer: »Über Geld sprechen — wie gräßlich.« Ein Ä fällt bei ihr hin und wieder, sie spricht es ganz nah an E aus. Wir bekamen nur sehr wenig Taschengeld. Zum Glück hatten wir eine große Verwandtschaft, wenn sie alle zusammengetrommelt wurden, kamen fünfzig bis sechzig Onkels und Tanten zusammen, und einige davon waren so nett, uns hin und wieder etwas Geld zuzustecken, weil die Sparsamkeit meiner Mutter sprichwörtlich war. Zu allem Überfluß ist die Mutter meiner Mutter adelig gewesen, eine von Hohenbrode, und mein Vater kommt sich heute noch wie ein gnädig aufgenommener Schwiegersohn vor, obwohl sein Schwiegervater Tuhler hieß, nur seine Schwiegermutter eine geborene von Hohenbrode war. Die Deutschen sind ja heute adelsüchtiger und adelsgläubiger als 1910. Sogar Menschen, die für intelligent gehalten werden, reißen sich um Adelsbekanntschaften. Ich müßte auch auf diese Tatsache einmal Mutters Zentralkomitee aufmerksam machen. Es ist eine Rassenfrage. Selbst ein so vernünftiger Mann wie mein Großvater kann es nicht verwinden, daß die Schniers im Sommer 1918 schon geadelt werden sollten, daß es »sozusagen« schon aktenkundig war, aber dann türmte im entscheidenden Augenblick der Kaiser, der das Dekret hätte unterschreiben müssen — er hatte wohl andere Sorgen — wenn er überhaupt je Sorgen gehabt hat. Diese Geschichte von dem »fast-Adel« der Schniers wird noch heute nach fast einem halben Jahrhundert bei jeder Gelegenheit erzählt. »Man hat das Dekret in Seiner Majestät Schreibmappe gefunden«, sagt mein Vater immer. Ich wundere mich, daß keiner nach Doorn gefahren ist und das Ding noch hat unterschreiben lassen. Ich hätte einen reitenden Boten dorthin geschickt, dann wäre die Angelegenheit wenigstens in einem ihr angemessenen Stil erledigt worden. Ich dachte, wie Marie, wenn ich schon in der Badewanne lag, die Koffer auspackte. Wie sie vor dem Spiegel stand, die Handschuhe auszog, die Haare glatt strich; wie sie die Bügel aus dem Schrank nahm, die Kleider darüber hängte, die Bügel wieder in den Schrank; sie knirschten auf der Messingstange. Dann die Schuhe, das leise Geräusch der Absätze, das Scharren der Sohlen, und wie sie ihre Tuben, Fläschchen und Tiegel auf die Glasplatte am Toilettentisch stellte; den großen Cremetiegel, oder die schmale Nagellackflasche, die Puderdose und den harten metallischen Laut des aufrecht hingestellten Lippenstifts.