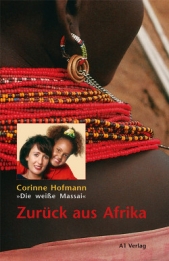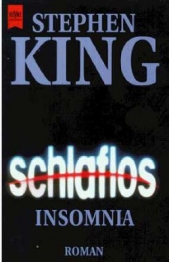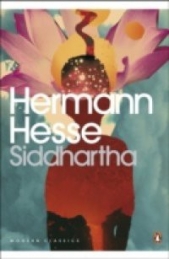Ansichten eines Clowns

Ansichten eines Clowns читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Schlafen kann ich wie ein Tier, meistens traumlos, oft nur für Minuten, und habe doch das Gefühl, eine Ewigkeit lang weg gewesen zu sein, als hätte ich den Kopf durch eine Wand gesteckt, hinter der dunkle Unendlichkeit liegt, Vergessen und ewiger Feierabend, und das, woran Henriette dachte, wenn sie plötzlich den Tennisschläger auf den Boden, den Löffel in die Suppe fallen ließ oder mit einem kurzen Schwung die Spielkarten ins Feuer warf: nichts. Ich fragte sie einmal, woran sie denke, wenn es über sie käme, und sie sagte: »Weißt du es wirklich nicht?« — »Nein«, sagte ich, und sie sagte leise: »An nichts, ich denke an nichts.« Ich sagte, man könne doch gar nicht an nichts denken, und sie sagte: »Doch, das kann man, ich bin dann plötzlich ganz leer und doch wie betrunken, und ich möchte am liebsten auch noch die Schuhe abwerfen und die Kleider — ohne Ballast sein.« Sie sagte auch, es sei so großartig, daß sie immer darauf warte, aber es käme nie, wenn sie drauf warte, immer ganz unerwartet, und es sei wie eine Ewigkeit. Sie hatte es auch ein paarmal in der Schule gehabt, ich erinnere mich der heftigen Telefongespräche meiner Mutter mit der Klassenlehrerin und des Ausdrucks: »Ja, ja, hysterisch, das ist das Wort — und bestrafen Sie sie hart.«
Ich habe ein ähnliches Gefühl der großartigen Leere manchmal beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielen, wenn es über drei, vier Stunden lang dauert; allein die Geräusche, das Klappern des Würfels, das Tappen der Puppen, das Klick, wenn man eine Puppe schlägt. Ich brachte sogar Marie, die mehr zum Schachspielen neigt, dazu, süchtig auf dieses Spiel zu werden. Es war wie ein Narkotikum für uns. Wir spielten es manchmal fünf, sechs Stunden lang hintereinander, und Kellner und Zimmermädchen, die uns Tee oder Kaffee brachten, hatten die gleiche Mischung aus Angst und Wut im Gesicht wie meine Mutter, wenn es über Henriette kam, und manchmal sagten sie, was die Leute im Bus gesagt hatten, als ich von Marie nach Hause fuhr: »Unglaublich.« Marie erfand ein sehr kompliziertes Anschreibesystem mit Punkten: je nachdem, wo einer rausgeschmissen wurde oder einen rausschmiß, bekam er Punkte, eine interessante Tabelle entwickelte sie, und ich kaufte ihr einen Vierfarbenstift, weil sie die passiven Werte und die aktiven Werte, wie sie sie nannte, dann besser markieren konnte. Manchmal spielten wir es auch während langer Eisenbahnfahrten zum Erstaunen seriöser Fahrgäste — bis ich ganz plötzlich merkte, daß Marie nur noch mit mir spielte, weil sie mir eine Freude machen, mich beruhigen, meiner »Künstlerseele« Entspannung verschaffen wollte. Sie war nicht mehr dabei, vor ein paar Monaten fing es an, als ich mich weigerte, nach Bonn zu fahren, obwohl ich fünf Tage lang hintereinander keine Vorstellung hatte. Ich wollte nicht nach Bonn. Ich hatte Angst vor dem Kreis, hatte Angst, Leo zu begegnen, aber Marie sagte dauernd, sie müsse noch einmal »katholische Luft« atmen. Ich erinnerte sie daran, wie wir nach dem ersten Abend im Kreis von Bonn nach Köln zurückgefahren waren, müde, elend und niedergeschlagen, und wie sie dauernd im Zug zu mir gesagt hatte: »Du bist so lieb, so lieb«, und an meiner Schulter geschlafen hatte, manchmal nur war sie aufgeschreckt, wenn draußen der Schaffner die Stationsnamen aufrief: Sechtem, Walberberg, Brühl, Kaischeuren — sie zuckte jedesmal zusammen, schrak hoch, und ich drückte ihren Kopf wieder an meine Schulter, und als wir in Köln-West ausstiegen, sagte sie: »Wir wären besser ins Kino gegangen.« Ich erinnerte sie daran, als sie von der katholischen Luft, die sie atmen müsse, anfing und schlug ihr vor, ins Kino zu gehen, zu tanzen, Mensch-ärgere-dich-nicht zu spielen, aber sie schüttelte den Kopf und fuhr dann allein nach Bonn. Ich kann mir unter katholischer Luft nichts vorstellen. Schließlich waren wir in Osnabrück, und so ganz unkatholisch konnte die Luft dort nicht sein.
11
Ich ging ins Badezimmer, kippte etwas von dem Badezeug, das Monika Silvs mir hingestellt hatte, in die Wanne und drehte den Heißwasserhahn auf. Baden ist fast so gut wie schlafen, wie schlafen fast so gut ist, wie »die Sache« tun. Marie hat es so genannt, und ich denke immer in ihren Worten daran. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, daß sie mit Züpfner »die Sache« tun würde, meine Phantasie hat einfach keine Kammern für solche Vorstellungen, so wie ich nie ernsthaft in Versuchung war, in Maries Wäsche zu kramen. Ich konnte mir nur vorstellen, daß sie mit Züpfner Mensch-ärgere-dich-nicht spielen würde — und das machte mich rasend. Nichts, was ich mit ihr getan hatte, konnte sie doch mit ihm tun, ohne sich als Verräterin oder Hure vorzukommen. Sie konnte ihm noch nicht mal Butter aufs Brötchen streichen. Wenn ich mir vorstellte, daß sie seine Zigarette aus dem Aschenbecher nehmen und weiterrauchen würde, wurde ich fast wahnsinnig, und die Einsicht, daß er Nichtraucher war und wahrscheinlich Schach mit ihr spielen würde, bot keinen Trost. Irgend etwas mußte sie ja mit ihm tun, tanzen oder Kartenspielen, er ihr oder sie ihm vorlesen, und sprechen mußte sie mit ihm, übers Wetter und über Geld. Sie konnte eigentlich nur für ihn kochen, ohne dauernd an mich denken zu müssen, denn das hat sie so selten für mich getan, daß es nicht unbedingt Verrat oder Hurerei sein würde. Am liebsten hätte ich gleich Sommerwild angerufen, aber es war noch zu früh, ich hatte mir vorgenommen, ihn gegen halb drei Uhr früh aus dem Schlaf zu wecken und mich mit ihm ausgiebig über Kunst zu unterhalten. Acht Uhr am Abend, das war eine zu anständige Zeit, ihn anzurufen und ihn zu fragen, wieviel Ordnungsprinzipien er Marie schon zu fressen gegeben hatte und welche Provision er von Züpfner bekommen würde: ein Abtkreuz aus dem dreizehnten Jahrhundert oder eine mittelrheinische Madonna aus dem vierzehnten. Ich dachte auch darüber nach, auf welche Weise ich ihn umbringen würde. Ästheten bringt man wohl am besten mit wertvollen Kunstgegenständen um, damit sie sich noch im Tode über einen Kunstfrevel ärgern. Eine Madonna wäre nicht wertvoll genug und zu stabil, dann könnte er noch mit dem Trost sterben, die Madonna wäre gerettet, und ein Gemälde ist nicht schwer genug, höchstens der Rahmen, und das gäbe ihm wieder den Trost, das Gemälde selbst könnte erhalten bleiben. Von einem wertvollen Gemälde könnte ich vielleicht die Farbe abkratzen und ihn mit der Leinwand ersticken oder strangulieren: kein perfekter Mord, aber ein perfekter Ästhetenmord. Es würde auch nicht leicht sein, einen so kerngesunden Burschen in sein Jenseits zu befördern, Sommerwild ist groß und schlank, eine »würdige Erscheinung«, weißhaarig und »gütig«, Alpinist und stolz darauf, daß er an zwei Weltkriegen teilgenommen und das silberne Sportabzeichen gemacht hat. Ein zäher, gut trainierter Gegner. Ich mußte unbedingt einen wertvollen Kunstgegenstand aus Metall auftreiben, aus Bronze oder Gold, vielleicht auch aus Marmor, aber ich konnte ja schlecht vorher nach Rom fahren und aus den vatikanischen Museen etwas klauen. Während das Badewasser einlief, fiel mir Blothert ein, ein wichtiges Mitglied des Kreises, das ich nur zweimal gesehen hatte. Er war so etwas wie der »rechte Gegenspieler« von Kinkel, Politiker wie dieser, aber »mit anderem Hintergrund und aus anderem Raum kommend«; für ihn war Züpfner, was Fredebeul für Kinkel war: eine Art Adlatus, auch »geistiger Erbe«, aber Blothert anzurufen wäre weniger sinnvoll gewesen, als wenn ich meine Wohnzimmerwände um Hilfe gebeten hätte. Das einzige, was in ihm halbwegs erkennbare Lebenszeichen hervorrief, waren Kinkels Barockmadonnen. Er verglich sie auf eine Weise mit seinen, die mir klar machte, wie abgründig die beiden einander hassen. Er war Präsident von irgend etwas, von dem Kinkel gern Präsident geworden wäre, sie duzten sich noch von einer gemeinsamen Schule her. Ich erschrak jedes der beiden Male, als ich Blothert sah. Er war mittelgroß, hellblond und sah wie fünfundzwanzig aus, wenn einer ihn ansah, grinste er, wenn er etwas sagte, knirschte er erst eine halbe Minute mit den Zähnen, und von vier Worten, die er sagte, waren zwei »der Kanzler« und »katholon« — und dann sah man plötzlich, daß er über fünfzig war, und er sah aus wie ein durch geheimnisvolle Laster gealterter Abiturient. Unheimliche Erscheinung. Manchmal verkrampfte er sich, wenn er ein paar Worte sagte, fing an zu stottern und sagte »der Ka ka ka ka«, oder »das ka ka ka«, und ich hatte Mitleid mit ihm, bis er endlich das restliche »nzler« oder »tholon« herausgespuckt hatte. Marie hatte mir von ihm erzählt, er sei auf eine geradezu »sensationelle Weise intelligent«. Ich habe nie Beweise für diese Behauptung bekommen, ihn nur bei einer Gelegenheit mehr als zwanzig Worte sprechen hören: als im Kreis über die Todesstrafe gesprochen wurde. Er war »ohne jede Einschränkung dafür« gewesen, und was mich an dieser Äußerung verwunderte, war nur die Tatsache, daß er nicht das Gegenteil heuchelte. Er sprach mit einer triumphierenden Wonne im Gesicht, verhaspelte sich wieder mit seinem Ka ka, und es klang, als schlage er bei jedem Ka jemand den Kopf ab. Er sah mich manchmal an, und jedesmal mit einem Staunen, als müßte er sich »unglaublich« verkneifen, das Kopfschütteln verkniff er sich nicht. Ich glaube, jemand, der nicht katholisch ist, existiert für ihn gar nicht. Ich dachte immer, wenn die Todesstrafe eingeführt würde, würde er dafür plädieren, alle Nichtkatholiken hinzurichten. Er hatte auch eine Frau, Kinder und ein Telefon. Dann wollte ich doch lieber noch einmal meine Mutter anrufen. Blothert fiel mir ein, als ich an Marie dachte. Er würde ja bei ihr aus- und eingehen, er hatte irgend etwas mit dem Dachverband zu tun, und die Vorstellung, daß er zu ihren Dauergästen gehören wird, machte mir Angst. Ich habe sie sehr gern, und ihre Pfadfinderworte: »Ich muß den Weg gehen, den ich gehen muß«, waren vielleicht wie die Abschiedslosung einer Urchristin zu verstehen, die sich den Raubtieren vorwerfen läßt. Ich dachte auch an Monika Silvs und wußte, daß ich irgendwann ihre Barmherzigkeit annehmen würde. Sie war so hübsch und so lieb, und sie war mir im Kreis noch weniger passend vorgekommen als Marie. Ob sie in der Küche hantierte — ich hatte auch ihr einmal geholfen, Schnittchen zu machen —, ob sie lächelte, tanzte oder malte, es war so selbstverständlich, wenn auch die Bilder, die sie malte, mir nicht gefielen. Sie hatte sich von Sommerwild zu viel von Verkündigung und Aussage vorreden lassen und malte fast nur noch Madonnen. Ich würde versuchen, ihr das auszureden. Es kann ja gar nicht gelingen, selbst wenn man dran glaubt und gut malen kann. Sie sollten die ganze Madonnenmalerei den Kindern überlassen oder frommen Mönchen, die sich nicht für Künstler halten. Ich überlegte, ob es mir gelingen würde, Monika das Madonnenmalen auszureden. Sie ist keine Dilettantin, noch jung, zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig, bestimmt unberührt — und diese Tatsache flößt mir Angst ein. Es kam mir der fürchterliche Gedanke, daß die Katholiken mir die Rolle zugedacht hatten, für sie den Siegfried zu spielen. Sie würde schließlich mit mir ein paar Jahre zusammenleben, nett sein, bis die Ordnungsprinzipien zu wirken anfingen, und dann würde sie nach Bonn zurückkehren und von Severn heiraten. Ich wurde rot bei diesem Gedanken und ließ ihn fallen. Monika war so lieb, und ich mochte sie nicht zum Gegenstand boshafter Überlegungen machen. Falls ich mich verabredete, mußte ich ihr zunächst Sommerwild ausreden, diesen Salonlöwen, der fast wie mein Vater aussieht. Nur stellt mein Vater keinen anderen Anspruch, als ein halbwegs humaner Ausbeuter zu sein, und diesem Anspruch genügt er. Bei Sommerwild habe ich immer den Eindruck, daß er genausogut Kur- oder Konzertdirektor, Public-relations-Manager einer Schuhfabrik, ein gepflegter Schlagersänger, vielleicht auch Redakteur einer »gescheit« gemachten, modischen Zeitschrift sein könnte. Er hält jeden Sonntagabend eine Predigt in St. Korbinian. Marie hat mich zweimal dorthin geschleppt. Die Vorführung ist peinlicher, als Sommerwilds Behörden erlauben sollten. Da lese ich doch lieber Rilke, Hofmannsthal, Newman einzeln, als daß ich mir aus den dreien eine Art Honigwasser zurechtmischen lasse. Mir brach während der Predigt der Schweiß aus.