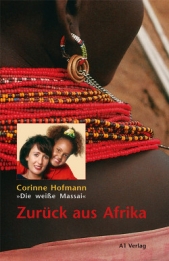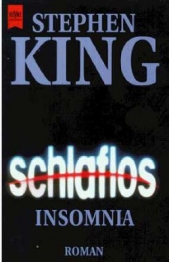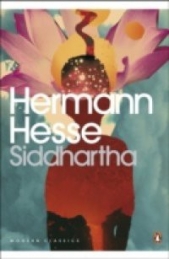Ansichten eines Clowns

Ansichten eines Clowns читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
9
Es dauerte auch bei Fredebeul lange, bis jemand an den Apparat kam; das dauernde Tuten machte mich nervös, ich stellte mir vor, daß Frau Fredebeul schlief, von dem Tuten geweckt wurde, wieder einschlief, wieder geweckt wurde, und ich durchlitt alle Qualen ihrer von diesem Anruf betroffenen Ohren. Ich war drauf und dran, wieder aufzulegen, gestand mir aber eine Art Notstand zu und ließ es weiterklingeln. Fredebeul selbst aus tiefem Schlaf zu wecken, hätte mich nicht im geringsten gequält: dieser Bursche hat keinen ruhigen Schlaf verdient; er ist krankhaft ehrgeizig, hat wahrscheinlich immer die Hand auf dem Telefon liegen, um anzurufen oder Anrufe anzunehmen, von Ministerialdirektoren, Redakteuren, Zentralkomitees, Dachverbänden und von der Partei. Seine Frau habe ich gern. Sie war noch Schülerin, als er sie zum erstenmal mit in den Kreis brachte, und die Art, wie sie da saß, mit ihren hübschen Augen den theologisch-soziologischen Auseinandersetzungen folgte, machte mich ganz elend. Ich sah ihr an, daß sie viel lieber tanzen oder ins Kino gegangen wäre. Sommerwild, bei dem diese Zusammenkunft stattfand, fragte mich dauernd: Ist Ihnen zu heiß, Schnier, und ich sagte: Nein, Prälat, obwohl mir der Schweiß von Stirn und Wangen lief. Ich ging schließlich auf Sommerwilds Balkon, weil ich das Gerede nicht mehr ertragen konnte. Sie selbst hatte das ganze Palaver ausgelöst, weil sie — übrigens vollkommen außer dem Zusammenhang des Gesprächs, das eigentlich über Größe und Grenzen des Provinzialismus ging — gesagt hatte, sie fände einiges, was Benn geschrieben hätte, doch »ganz hübsch«. Daraufhin wurde Fredebeul, als dessen Verlobte sie galt, knallrot, denn Kinkel warf ihm einen seiner berühmten sprechenden Blicke zu: »Wie, das hast du noch nicht bei ihr in Ordnung gebracht?« Er brachte es also selbst in Ordnung und schreinerte das arme Mädchen zurecht, indem er das ganze Abendland als Hobel ansetzte. Es blieb fast nichts von dem netten Mädchen übrig, die Späne flogen, und ich ärgerte mich über diesen Feigling Fredebeul, der nicht eingriff, weil er mit Kinkel auf eine bestimmte ideologische Linie »verschworen« ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob links oder rechts, jedenfalls haben sie ihre Linie, und Kinkel fühlte sich moralisch verpflichtet, Fredebeuls Braut auszurichten. Auch Sommerwild rührte sich nicht, obwohl er die Kinkel und Fredebeul entgegengesetzte Linie vertritt, ich weiß nicht welche: wenn Kinkel und Fredebeul links sind, ist Sommerwild rechts, oder umgekehrt. Auch Marie war ein bißchen blaß geworden, aber ihr imponiert Bildung — das habe ich ihr nie ausreden können —, und Kinkels Bildung imponierte auch der späteren Frau Fredebeul: sie nahm mit fast schon unzüchtigen Seufzern die wortstarke Belehrung hin: Das ging von den Kirchenvätern bis Brecht wie ein Unwetter nieder, und als ich erfrischt vom Balkon zurückkam, saßen alle vollkommen erschossen da, tranken Bowle — und das ganze nur, weil das arme Ding gesagt hatte, sie fände einiges von Benn »ganz hübsch«. Jetzt hat sie schon zwei Kinder von Fredebeul, ist kaum zweiundzwanzig, und während das Telefon immer noch in ihrer Wohnung klingelte, stellte ich mir vor, wie sie irgendwo mit Babyflaschen, Puderdosen, Windeln und Cremes herumhantierte, vollkommen hilflos und konfus, und ich dachte an die Berge von schmutziger Babywäsche und das ungespülte, fettige Geschirr in ihrer Küche. Ich hatte ihr einmal, als mir die Unterhaltung zu anstrengend wurde, geholfen, Toast zu rösten, Schnittchen zu machen und Kaffee zu kochen, Arbeiten, von denen ich nur sagen kann, daß sie mir weniger widerwärtig sind als gewisse Formen der Unterhaltung.
Eine sehr zaghafte Stimme sagte: »Ja, bitte?« und ich konnte aus dieser Stimme heraushören, daß es in Küche, Badezimmer und Schlafzimmer hoffnungsloser aussah als je. Riechen konnte ich diesmal fast nichts: nur, daß sie eine Zigarette in der Hand haben mußte. »Schnier«, sagte ich, und ich hatte einen Ausruf der Freude erwartet, wie sie ihn immer tut, wenn ich sie anrufe. Ach, Sie in Bonn — wie nett — oder ähnlich, aber sie schwieg verlegen, sagte dann schwach: »Ach, nett.« Ich wußte nicht, was ich sagen sollte. Früher hatte sie immer gesagt: »Wann kommen Sie noch einmal und fuhren uns was vor?« Kein Wort. Es war mir peinlich, nicht meinet-, mehr ihretwegen, meinetwegen war es nur deprimierend, ihretwegen war es peinlich. »Die Briefe«, sagte ich schließlich mühsam, »die Briefe, die ich Marie an Ihre Adresse schickte?«
»Liegen hier«, sagte sie, »ungeöffnet zurückgekommen. «
»An welche Adresse hatten Sie sie denn nachgeschickt?« »Ich weiß nicht«, sagte sie, »das hat mein Mann gemacht. «
»Aber Sie müssen doch auf den zurückkommenden Briefen gesehen haben, welche Adresse er drauf geschrieben hat?« »Wollen Sie mich verhören?«
»O nein«, sagte ich sanft, »nein, nein, ich dachte nur ganz bescheiden, ich könnte ein Recht haben, zu erfahren, was mit meinen Briefen geschehen ist.«
»Die Sie, ohne uns zu fragen, hierhergeschickt haben.«
»Liebe Frau Fredebeul«, sagte ich, »bitte, werden Sie jetzt menschlich.«
Sie lachte, matt, aber doch hörbar, sagte aber nichts.
»Ich meine«, sagte ich, »es gibt doch einen Punkt, wo die Menschen, wenn auch aus ideologischen Gründen — menschlich werden.«
»Soll das heißen, daß ich mich bisher unmenschlich verhalten habe?«
»Ja«, sagte ich. Sie lachte wieder, sehr matt, aber immer noch hörbar.
»Ich bin sehr unglücklich über diese Geschichte«, sagte sie schließlich, »aber mehr kann ich nicht sagen. Sie haben uns alle eben schrecklich enttäuscht.«
»Als Clown?« fragte ich.
»Auch«, sagte sie, »aber nicht nur.«
»Ihr Mann ist wohl nicht zu Hause?«
»Nein«, sagte sie, »er kommt erst in ein paar Tagen zurück. Er hält Wahlreden in der Eifel.«
»Was?« rief ich; das war wirklich eine Neuigkeit, »doch nicht für die CDU?«
»Warum nicht«, sagte sie in einem Ton, der mir deutlich zu verstehen gab, daß sie gern einhängen würde.
»Na gut«, sagte ich, »ist es zuviel verlangt, wenn ich Sie bitte, mir meine Briefe hierherzuschicken.«
»Wohin?«
»Nach Bonn — hier an meine Bonner Adresse.«
»Sie sind in Bonn?« fragte sie, und es kam mir so vor, als ob sie ein »Um Gottes willen« unterdrücke.
»Auf Wiedersehen«, sagte ich, »und dank für soviel Humanität.« Es tat mir leid, daß ich so böse mit ihr war, ich war am Ende. Ich ging in die Küche, nahm den Kognak aus dem Eisschrank und nahm einen tiefen Schluck. Es half nichts, ich nahm noch einen, es half ebensowenig. Von Frau Fredebeul hatte ich eine solche Abfertigung am wenigsten erwartet. Ich hatte mit einem langen Sermon über die Ehe gerechnet, mit Vorwürfen über mein Verhalten Marie gegenüber; sie konnte auf eine nette, konsequente Weise dogmatisch sein, aber meistens, wenn ich in Bonn war und sie anrief, hatte sie mich scherzhaft aufgefordert, ihr doch noch einmal in Küche und Kinderzimmer zu helfen. Ich mußte mich in ihr getäuscht haben, oder vielleicht war sie wieder schwanger und schlecht gelaunt. Ich hatte nicht den Mut, noch einmal anzurufen und möglicherweise herauszukriegen, was mit ihr los war. Sie war immer so nett zu mir gewesen. Ich konnte es mir nicht anders erklären, als daß Fredebeul ihr »strikte Anweisungen« gegeben hatte, mich so abzufertigen. Mir ist schon oft aufgefallen, daß Ehefrauen loyal gegenüber ihrem Mann sind bis zum völligen Wahnsinn. Frau Fredebeul war wohl zu jung, als daß sie hätte wissen können, wie sehr mich ihre unnatürliche Kälte treffen würde, und ich konnte ihr wohl nicht zumuten, einzusehen, daß Fredebeul nicht viel mehr ist als ein opportunistischer Schwätzer, der um jeden Preis Karriere machen will und seine Großmutter »fallen lassen« würde, wenn sie ihm hinderlich wäre. Sicher hatte er ihr gesagt: »Schnier abschreiben«, und sie schrieb mich einfach ab. Sie war ihm Untertan, und solange er gemeint hatte, ich sei zu irgend etwas nütze, hatte sie ihrer Natur folgen und nett zu mir sein dürfen, jetzt mußte sie gegen ihre Natur schnöde zu mir sein. Vielleicht tat ich ihnen auch unrecht, und sie folgten beide nur ihrem Gewissen. Wenn Marie mit Züpfner verheiratet war, war es wohl sündhaft, wenn sie mir Kontakt mit ihr verschafften — daß Züpfner der Mann im Dachverband war und Fredebeul nützen konnte, machte dem Gewissen keine Schwierigkeiten. Sicher mußten die das Gute und Richtige auch dann tun, wenn es ihnen nützte. Über Fredebeul war ich weniger erschrocken als über seine Frau. Über ihn hatte ich mir nie Illusionen gemacht, und nicht einmal die Tatsache, daß er jetzt Wahlreden für die CDU hielt, konnte mich in Erstaunen versetzen.