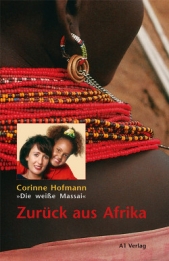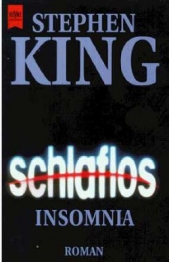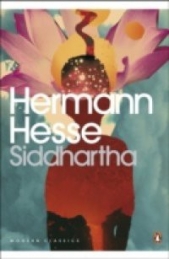Ansichten eines Clowns

Ansichten eines Clowns читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Es ging ihr schlecht an diesem Abend, sie war blaß und müde, sprach ziemlich laut mit mir, und als ich dann sagte, ja, gut, ich würde alles tun, auch diese Sachen unterschreiben, wurde sie böse und sagte: »Das tust du jetzt nur aus Faulheit, und nicht, weil du von der Berechtigung abstrakter Ordnungsprinzipien überzeugt bist«, und ich sagte ja, ich tat es tatsächlich aus Faulheit und weil ich sie gern mein ganzes Leben lang bei mir haben möchte, und ich würde sogar regelrecht zur katholischen Kirche übertreten, wenn es nötig sei, um sie zu behalten. Ich wurde sogar pathetisch und sagte, ein Wort wie »abstrakte Ordnungsprinzipien« erinnere mich an eine Folterkammer. Sie empfand es als Beleidigung, daß ich, um sie zu behalten, sogar katholisch werden wollte. Und ich hatte geglaubt, ihr auf eine Weise geschmeichelt zu haben, die fast zu weit ging. Sie sagte, es ginge jetzt nicht mehr um sie und um mich, sondern um die »Ordnung«.
Es war Abend, in einem Hotelzimmer in Hannover, in einem von diesen teuren Hotels, wo man, wenn man eine Tasse Kaffee bestellt, nur eine dreiviertel Tasse Kaffee bekommt. Sie sind in diesen Hotels so fein, daß eine volle Tasse Kaffee als ordinär gilt, und die Kellner wissen viel besser, was fein ist, als die feinen Leute, die dort die Gäste spielen. Ich komme mir in diesen Hotels immer vor wie in einem besonders teuren und besonders langweiligen Internat, und ich war an diesem Abend todmüde: drei Auftritte hintereinander. Am frühen Nachmittag vor irgendwelchen Stahlaktionären, nachmittags vor Lehramtskandidaten und abends in einem Varieté, wo der Applaus so matt war, daß ich den nahenden Untergang schon heraushörte.
Als ich mir in diesem dummen Hotel Bier aufs Zimmer bestellte, sagte der Oberkellner so eisig am Telefon: »Jawoll, mein Herr«, als hätte ich Jauche gewünscht, und sie brachten mir das Bier in einem Silberbecher. Ich war müde, ich wollte nur noch Bier trinken, ein bißchen Mensch-ärgere-dich-nicht spielen, ein Bad nehmen, die Abendzeitungen lesen und neben Marie einschlafen: meine rechte Hand auf ihrer Brust und mein Gesicht so nah an ihrem Kopf, daß ich den Geruch ihres Haars mit in den Schlaf nehmen konnte. Ich hatte noch den matten Applaus im Ohr. Es wäre fast humaner gewesen, sie hätten alle den Daumen zur Erde gekehrt. Diese müde, blasierte Verachtung meiner Nummern war so schal wie das Bier in dem dummen Silberbecher. Ich war einfach nicht in der Lage, ein weltanschauliches Gespräch zu fuhren.
»Es geht um die Sache, Hans«, sagte sie, etwas weniger laut, und sie merkte nicht einmal, daß >Sache< für uns eine bestimmte Bedeutung hatte; sie schien es vergessen zu haben. Sie ging vor dem Fußende des Doppelbettes auf und ab und schlug beim Gestikulieren mit der Zigarette jedesmal so präzis in die Luft, daß die kleinen Rauchwölkchen wie Punkte wirkten. Sie hatte inzwischen Rauchen gelernt, in dem lindgrünen Pullover sah sie schön aus: die weiße Haut, das Haar dunkler als früher, ich sah an ihrem Hals zum erstenmal Sehnen. Ich sagte: »Sei doch barmherzig, laß mich erst mal ausschlafen, wir wollen morgen beim Frühstück noch einmal über alles reden, vor allem über die Sache«, aber sie merkte nichts, drehte sich um, blieb vor dem Bett stehen, und ich sah ihrem Mund an, daß es Motive zu diesem Auftritt gab, die sie sich selbst nicht eingestand. Als sie an der Zigarette zog, sah ich ein paar Fältchen um ihren Mund, die ich noch nie gesehen hatte. Sie sah mich kopfschüttelnd an, seufzte, drehte sich wieder um und ging auf und ab.
»Ich versteh nicht ganz«, sagte ich müde, »erst streiten wir um meine Unterschrift unter dieses Erpressungsformular — dann um die standesamtliche Trauung — jetzt bin ich zu beidem bereit, und du bist noch böser als vorher.«
»Ja«, sagte sie, »es geht mir zu rasch, und ich spüre, daß du die Auseinandersetzung scheust. Was willst du eigentlich?« »Dich«, sagte ich, und ich weiß nicht, ob man einer Frau etwas Netteres sagen kann.
»Komm«, sagte ich, »leg dich neben mich und bring den Aschenbecher mit, dann können wir viel besser reden.« Ich konnte das Wort Sache nicht mehr in ihrer Gegenwart aussprechen. Sie schüttelte den Kopf, stellte mir den Aschenbecher aufs Bett, ging zum Fenster und blickte hinaus. Ich hatte Angst. »Irgend etwas an diesem Gespräch gefällt mir nicht — es klingt nicht nach dir!«
»Wonach denn?« fragte sie leise, und ich fiel auf die plötzlich wieder so sanfte Stimme herein.
»Sie riecht nach Bonn«, sagte ich, »nach dem Kreis, nach Sommerwild und Züpfner — und wie sie alle heißen.«
»Vielleicht«, sagte sie, ohne sich umzudrehen, »bilden deine Ohren sich ein, gehört zu haben, was deine Augen gesehen haben.«
»Ich versteh dich nicht«, sagte ich müde, »was meinst du.«
»Ach«, sagte sie, »als ob du nicht wüßtest, daß hier Katholikentag ist.«
»Ich hab die Plakate gesehen«, sagte ich. »Und daß Heribert und Prälat Sommerwild hier sein könnten, ist dir nicht in den Sinn gekommen?« Ich hatte nicht gewußt, daß Züpfner mit Vornamen Heribert hieß. Als sie den Namen nannte, fiel mir ein, daß nur er gemeint sein konnte. Ich dachte wieder an das Händchenhalten. Mir war schon aufgefallen, daß in Hannover viel mehr katholische Priester und Nonnen zu sehen waren als zu der Stadt zu passen schien, aber ich hatte nicht daran gedacht, daß Marie hier jemand treffen könnte, und selbst wenn — wir waren ja manchmal, wenn ich ein paar Tage frei hatte, nach Bonn gefahren, und sie hatte den ganzen »Kreis« ausgiebig genießen können.
»Hier im Hotel?« fragte ich müde.
»Ja«, sagte sie.
»Warum hast du mich nicht mit ihnen zusammengebracht?«
»Du warst ja kaum hier«, sagte sie, »eine Woche lang immer unterwegs — Braunschweig, Hildesheim, Celle...«
»Aber jetzt habe ich Zeit«, sagte ich, »ruf sie an, und wir trinken noch was unten in der Bar.«
»Sie sind weg«, sagte sie, »heute nachmittag gefahren.«
»Es freut mich«, sagte ich, »daß du so lange und ausgiebig >katholische Luft< hast atmen können, wenn auch importierte.« Das war nicht mein, sondern ihr Ausdruck. Manchmal hatte sie gesagt, sie müsse mal wieder katholische Luft atmen.
»Warum bist du böse«, sagte sie; sie stand immer noch mit dem Gesicht zur Straße, rauchte schon wieder, und auch das war mir fremd an ihr: dieses hastige Rauchen, es war mir so fremd wie die Art, in der sie mit mir sprach. In diesem Augenblick hätte sie Irgendeine sein können, eine Hübsche, nicht sehr Intelligente, die irgendeinen Vorwand suchte, um zu gehen.
»Ich bin nicht böse«, sagte ich, »du weißt es. Sag mir nur, daß du's weißt.«
Sie sagte nichts, nickte aber, und ich konnte genug von ihrem Gesicht sehen, um zu wissen, daß sie die Tränen zurückhielt. Warum? Sie hätte weinen sollen, heftig und lange. Dann hätte ich aufstehen, sie in den Arm nehmen und küssen können. Ich tat es nicht. Ich hatte keine Lust, und nur aus Routine oder Pflicht wollte ich's nicht tun. Ich blieb liegen. Ich dachte an Züpfner und Sommerwild, daß sie drei Tage lang mit denen hier herumgeredet hatte, ohne mir etwas davon zu erzählen. Sie hatten sicherlich über mich gesprochen. Züpfner gehört zum Dachverband katholischer Laien. Ich zögerte zu lange, eine Minute, eine halbe oder zwei, ich weiß nicht. Als ich dann aufstand und zu ihr ging, schüttelte sie den Kopf, schob meine Hände von ihrer Schulter weg und fing wieder an zu reden, von ihrem metaphysischen Schrecken und von Ordnungsprinzipien, und ich kam mir vor, als wäre ich schon zwanzig Jahre lang mit ihr verheiratet. Ihre Stimme hatte einen erzieherischen Ton, ich war zu müde, ihre Argumente aufzufangen, sie flogen an mir vorbei. Ich unterbrach sie und erzählte ihr von dem Reinfall, den ich im Varieté erlebt hatte, dem ersten seit drei Jahren. Wir standen nebeneinander am Fenster, blickten auf die Straße hinunter, wo dauernd Taxis vorfuhren, die katholische Komiteemitglieder zum Bahnhof brachten: Nonnen, Priester und seriös wirkende Laien. In einer Gruppe erkannte ich Schnitzler, er hielt einer sehr fein aussehenden alten Nonne die Taxitür auf. Als er bei uns wohnte, war er evangelisch. Er mußte entweder konvertiert sein oder als evangelischer Beobachter hier gewesen sein. Ihm war alles zuzutrauen. Unten wurden Koffer geschleppt und Trinkgelder in Hoteldienerhände gedrückt. Mir drehte sich vor Müdigkeit und Verwirrung alles vor den Augen: Taxis und Nonnen, Lichter und Koffer, und ich hatte dauernd den mörderisch müden Applaus im Ohr. Marie hatte längst ihren Monolog über die Ordnungsprinzipien abgebrochen, sie rauchte auch nicht mehr, und als ich vom Fenster zurücktrat, kam sie mir nach, faßte mich an der Schulter und küßte mich auf die Augen. »Du bist so lieb«, sagte sie »so lieb und so müde«, aber als ich sie umarmen wollte, sagte sie leise: »Bitte, bitte, nicht«, und es war falsch von mir, daß ich sie wirklich losließ. Ich warf mich in den Kleidern aufs Bett, schlief sofort ein, und als ich am Morgen wach wurde, war ich nicht erstaunt darüber, daß Marie gegangen war. Ich fand den Zettel auf dem Tisch: »Ich muß den Weg gehen, den ich gehen muß.« Sie war fast fünfundzwanzig, und es hätte ihr etwas Besseres einfallen müssen. Ich nahm es ihr nicht übel, es kam mir nur ein bißchen wenig vor. Ich setzte mich sofort hin und schrieb ihr einen langen Brief, nach dem Frühstück noch einen, ich schrieb ihr jeden Tag und schickte die Briefe alle an Fredebeuls Adresse nach Bonn, aber ich bekam nie Antwort.