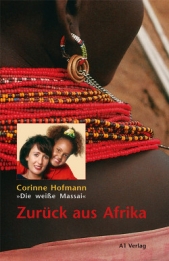Die weisse Massai
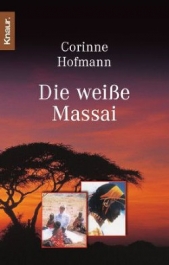
Die weisse Massai читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Während des Essens erzählt mir Giuliano, daß er demnächst für mindestens drei Monate Ferien in Italien macht. Ich freue mich für ihn, doch ist mir nicht wohl, ohne ihn hier zu sein. Wie oft war er doch ein rettender Engel in der Not!
Wir sind gerade fertig mit dem Essen, als plötzlich mein Mann auftaucht. Die Situation ist sofort gespannt: „Corinne, why do you eat here and not wait for me at home?“
Er nimmt Napirai an sich und verläßt uns. Schnel bedanke ich mich bei den Missionaren und eile Lketinga und dem Baby nach. Napirai schreit. Als wir zu Hause sind, gibt er mir das Kind und fragt: „What do you have made with my baby, now she cries only, when she comes to me!“
Statt zu antworten, frage ich ihn, weshalb er schon zurück ist. Er lacht höhnisch:
„Because I know you go to other men, if I'm not here!“
Wütend über die ewigen Vorwürfe beschimpfe ich ihn, er sei crazy. „What do you tel me? I'm crazy? You tell your husband, he is crazy? I don't want see you again!“
Dabei packt er seine Speere und verläßt das Haus. Wie versteinert sitze ich da und verstehe es nicht, warum er mir dauernd andere Männer unterstellt. Nur weil wir längere Zeit keinen Sex mehr hatten? Ich kann doch nichts dafür, daß ich erst krank und dann so lange in Maralal war! Zudem haben Samburus sowieso keinen Sex während der Schwangerschaft.
Unsere Liebe hat bereits einige Schläge einstecken müssen, so kann es nicht weitergehen. In meiner Verzweiflung nehme ich Napirai und gehe zu Mama. So gut wie möglich versuche ich ihr die Situation zu schildern. Dabei laufen mir Tränen über das Gesicht. Sie sagt nicht viel dazu, und meint lediglich, es sei normal, daß die Männer eifersüchtig sind, ich solle einfach nicht hinhören. Dieser Rat tröstet mich wenig, und ich schluchze noch heftiger. Jetzt schimpft sie mit mir und sagt, ich hätte keinen Grund zu weinen, da er mich nicht geschlagen habe. Hier finde ich also auch keinen Trost und gehe traurig nach Hause.
Gegen Abend schaut meine Nachbarin, die Frau des Veterinärs, vorbei.
Anscheinend hat sie etwas mitbekommen von unserem Krach. Wir machen Chai und unterhalten uns zögernd. Die Krieger sind sehr eifersüchtig, meint sie, doch dürfe ich deshalb meinen Mann niemals crazy schimpfen. Das sei gefährlich.
Als sie geht, fühle ich mich mit Napirai sehr verlassen. Ich habe nichts gegessen seit gestern Mittag, aber wenigstens habe ich Milch im Überfluß für mein Baby. Diese Nacht kommt mein Mann nicht nach Hause. Langsam mache ich mir große Sorgen, ob er mich wirklich verlassen hat. Am nächsten Morgen fühle ich mich elend und komme kaum aus dem Bett. Meine Nachbarin schaut mittags wieder vorbei. Als sie sieht, daß es mir schlecht geht, hütet sie Napirai und wäscht al e Windeln. Dann holt sie Fleisch und kocht mit meinem letzten Reis ein Essen für mich. Ich bin gerührt über ihren Einsatz. Hier entwickelt sich das erste Mal eine Freundschaft, in der nicht ich, die Mzungu, gebe, sondern mir eine Freundin ohne Aufforderung hilft. Tapfer esse ich den gefüllten Tel er leer. Sie will nichts, da sie schon gegessen hat.
Nachdem sie alle Arbeiten erledigt hat, geht sie nach Hause, um bei sich Ordnung zu machen.
Grußlos inspiziert Lketinga, als er am Abend endlich zurückkommt, alle Räume.
Ich versuche, möglichst normal zu sein und biete ihm Essen an, das er sogar annimmt. Das ist ein Zeichen, daß er zu Hause bleiben wird. Ich bin froh und schöpfe Hoffnung. Doch es kommt anders.
Quarantäne
Gegen neun Uhr bekomme ich schreckliche Magenkrämpfe. Ich liege im Bett und ziehe meine Beine bis zum Kinn hoch, damit es einigermaßen erträglich ist. Napirai kann ich so nicht stil en. Sie ist beim Papa und schreit. Diesmal zeigt er sich geduldig und läuft stundenlang singend in der Wohnung umher. Sie beruhigt sich nur kurz und schreit dann weiter. Gegen Mitternacht ist mir so schlecht, daß ich erbrechen muß.
Das ganze Essen kommt unverdaut hoch. Ich breche und breche und kann nicht mehr aufhören. Es kommt nur noch gelbe Flüssigkeit. Der Boden ist verschmutzt, doch ich fühle mich zu elend, um alles aufzuwischen. Mir ist kalt, und ich bin sicher, hohes Fieber zu haben.
Lketinga macht sich Sorgen und geht zur Nachbarin, obwohl es schon sehr spät ist. Es dauert nicht lange, und sie ist bei mir. Wie selbstverständlich putzt sie die ganze Misere auf. Besorgt fragt sie mich, ob ich vielleicht wieder Malaria habe. Ich weiß es nicht und hoffe, nicht schon wieder ins Spital zu müssen. Die Magenschmerzen lassen nach, und ich kann die Beine wieder strecken. Nun bin ich auch in der Lage, Napirai die Brust zu geben.
Die Nachbarin geht nach Hause, und mein Mann schläft neben meinem Bett auf einer zweiten Matratze. Morgens geht es mir einigermaßen, und ich trinke Chai, den Lketinga gekocht hat. Doch es dauert keine halbe Stunde, und der Tee schießt wie eine Fontäne unkontrol iert aus meinem Mund hervor. Gleichzeitig setzen wieder heftige Magenschmerzen ein. Sie werden so stark, daß ich in der Hocke am Boden sitze und die Beine anziehe. Nach einiger Zeit beruhigt sich der Magen wieder, und ich beginne mit dem Waschen des Babys und der Windeln. Sehr schnell bin ich völ ig ermattet, obwohl ich im Moment weder Schmerzen noch Fieber habe. Auch der typische Schüttelfrost bleibt aus. Ich bezweifle, daß es Malaria ist und denke eher an eine Magenverstimmung.
Jeder Versuch, etwas zu essen oder zu trinken, scheitert während der nächsten zwei Tage. Die Schmerzen halten länger und heftiger an. Meine Brüste schwinden, weil ich keine Nahrung behalten kann. Am vierten Tag bin ich total ausgelaugt und kann nicht mehr aufstehen. Meine Freundin kommt zwar jeden Tag und hilft, wo es nur geht, doch stillen muß ich schon selber.
Heute kommt Mama zu uns, weil Lketinga sie geholt hat. Sie schaut mich an und drückt auf meinem Magen herum, was höl ische Schmerzen verursacht. Dann deutet sie auf meine Augen, sie seien gelb, und auch mein Gesicht habe eine komische Farbe. Sie wil wissen, was ich gegessen habe. Aber außer Wasser habe ich ja schon lange nichts mehr bei mir behalten. Napirai schreit und wil gestillt werden, doch ich kann sie nicht mehr halten, da ich mich al ein nicht mehr aufrichten kann.
Mama hält sie an meine schlaffe Brust. Ich bezweifle, daß ich noch genug Milch habe und mache mir Sorgen, was mein Mädchen denn sonst zu sich nehmen kann. Da auch Mama zu dieser Krankheit keinen Rat weiß, beschließen wir, ins Spital nach Wamba zu fahren.
Lketinga fährt, während meine Freundin Napirai hält. Ich selbst bin zu schwach.
Natürlich ziehen wir uns unterwegs wieder einen Platten zu. Es ist zum Verzweifeln, ich hasse diesen Wagen. Mühsam setze ich mich in den Schatten und stille Napirai, während die beiden den Radwechsel vornehmen. Am späten Nachmittag erreichen wir Wamba. Ich schleppe mich zur Rezeption und frage nach der Schweizer Ärztin.
Mehr als eine Stunde vergeht, bis der italienische Arzt erscheint. Er fragt nach meinen Beschwerden und nimmt mir Blut ab. Nach einiger Zeit erfahren wir, daß es keine Malaria ist. Mehr weiß er erst morgen. Napirai bleibt bei mir, während mein Mann und meine Freundin erleichtert nach Barsaloi zurückfahren.
Wir kommen wieder in die Schwangerenabteilung, damit Napirai neben mir im Kinderbett schlafen kann. Da sie es nicht gewohnt ist, ohne mich einzuschlafen, schreit sie die ganze Zeit, bis eine Schwester sie zu mir ins Bett legt. Sofort saugt sie sich in den Schlaf. Am frühen Morgen erscheint endlich die Schweizer Ärztin. Sie ist nicht erfreut, als sie mich samt Kind in diesem Zustand wiedersieht.
Nach einigen Untersuchungen folgt ihre Diagnose: Hepatitis! Im ersten Moment verstehe ich nicht, was das ist. Besorgt erklärt sie mir, daß dies eine Gelbsucht, genauer gesagt eine Leberentzündung sei, die zudem noch ansteckend sei. Meine Leber verarbeitet keine Speisen mehr. Die Schmerzen werden durch die geringste Einnahme von Fett hervorgerufen. Ab sofort muß ich strengste Diät halten, absolute Ruhe haben und in Quarantäne gehen. Mit den Tränen kämpfend frage ich, wie lange es dauern wird. Mitleidig schaut sie Napirai und mich an und sagt: „Sicher sechs Wochen! Dann ist die Krankheit nicht mehr ansteckend, aber noch lange nicht ausgeheilt.“ Auch muß geprüft werden, wie es um Napirai steht. Sicher habe ich sie schon angesteckt! Jetzt kann ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Die gute Ärztin versucht, mich zu trösten, es sei ja noch nicht sicher, ob Napirai auch betroffen ist.