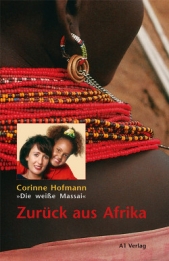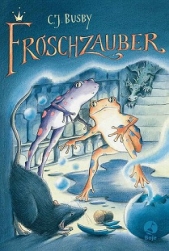Justiz

Justiz читать книгу онлайн
Justiz ist ein (Kriminal-) Roman. Er behandelt den ?ffentlichen Mord eines schweizer Kantonsrates an einem Professoren; erz?hlt aus der Ich-Perspektive des jungen Anwaltes Sp?t, der den Auftrag des verurteilten Kantonsrates annimmt, den Mord unter der Annahme, dieser sei nicht der M?rder, erneut zu untersuchen.
„Der junge Anwalt (…) erkennt zu sp?t, in welche Falle ihn die Justiz geraten l??t, weil er sie mit der Gerechtigkeit verwechselt. “ (Friedrich D?rrenmatt)
D?rrenmatt begann nach eigenen Worten mit der Arbeit an Justiz im Jahr 1957, der Roman sollte nach einigen Monaten abgeschlossen sein. Da jedoch Arbeit an anderen Werken dazwischen kam, blieb Justiz liegen, bis D?rrenmatt schlie?lich die Arbeit daran ganz einstellte. Im Jahr 1980 wollte er den Roman als 30. Band seiner Werkausgabe abschlie?en, scheiterte jedoch daran, dass er die urspr?nglich geplante Handlung nicht mehr rekonstruieren konnte. 1985 schlie?lich setzte er sich erneut daran, entwickelte auf dem vorhandenen Fragment eine neue Handlung; und so erschien der Roman, „wenn auch wohl in einem anderen Sinn als urspr?nglich geplant. “
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
2
Beginn der Recherchen: Mein besseres Leben begann mit Elan. Schon am nächsten Tag besaß ich das neue Büro und den Porsche endgültig, wenn sich auch der Wagen als älter herausstellte, als ich angenommen hatte, und sich in einem Zustand befand, der den Preis, den Lienhard verlangt hatte, etwas weniger menschenfreundlich erscheinen ließ. Das Büro,war jenes des ehemaligen Olympiasiegers im Fechten und Schweizermeisters im Pistolenschießen, Dr. Benno, gewesen, mit dem es seit langem abwärtsging. Der schöne Olympia-Heinz blieb der Verhandlung fern. Er sei bereit, wie Architekt Friedli erklärte, der mich in aller Herrgottsfrühe hingeführt hatte, mir das Büro zu überlassen, zweitausend im Monat, viertausend als Anzahlung, eine Summe, von der ich nicht wußte, in wessen Tasche sie floß, doch konnte ich das Büro sofort beziehen und nicht nur Bennos Mobiliar übernehmen, sondern auch seine Sekretärin, eine etwas verschlafene Innerschweizerin mit dem außerschweizerischen Namen Ilse Freude, die wie eine französische Bardame aussah, ihr Haar ständig anders färbte, doch erstaunlich tüchtig war; ein Kuhhandel, alles in allem, den ich nicht durchschaute. Dafür waren das Vorzimmer und das Büro am Zeltweg standesgemäß, mit Blick auf die obligaten Verkehrsstockungen, der Schreibtisch vertrauenerweckend, dazu ordentliche Sessel, gegen den Hinterhof eine Küche und ein Zimmer, in das ich meine Couch aus der Freiestraße stellte; ich vermochte mich vom alten Möbel nicht zu trennen. Auf einmal schien das Geschäft in Schwung zu kommen. Eine lukrative Ehescheidung stand in Aussicht, eine Reise nach Caracas winkte im Auftrag eines Großindustriellen (Kohler habe mich empfohlen), Erbstreitigkeiten waren zu schlichten, ein Möbelhändler war vor Gericht zu verteidigen, rentierende Steuererklärungen. Ich war in einer zu unvorsichtigen und beglückten Stimmung, um noch an die Privatdetektei zu denken, die ich in Bewegung gesetzt hatte und deren Bericht ich abwarten wollte, bevor ich den Fall Kohler weiterverfolgte. Dabei hätte mich Lienhard mißtrauischer machen sollen, als ich schon war: der Mann hatte Hintergrund, undurchsichtige Absichten, war mir von Kohler empfohlen worden und allzu begierig gewesen mitzumachen. Er ging gründlich vor. Ins >Du Théâtre< setzte er Schönbächler, einen seiner besten Männer, der am Neumarkt ein altes, doch komfortables Haus besaß. Den Estrich hatte er zu einer Wohndiele ausbauen lassen. Hier war seine gewaltige Diskothek untergebracht. Überall waren Lautsprecher montiert. Schönbächler liebte Symphonien. Seine Theorie (er war voller Theorien): Symphonien zwängen am wenigsten zum Mithören, man könne dazu gähnen, essen, lesen, schlafen, Gespräche führen usw., in ihnen hebe die Musik sich selber auf, werde unhörbar wie die Musik der Sphären. Den Konzertsaal lehnte er als barbarisch ab. Er mache aus der Musik einen Kult. Nur als Hintergrundmusik sei die Symphonie statthaft, behauptete er, nur als» Fond «sei sie etwas Humanes und nicht etwas Vergewaltigendes, so habe er die Neunte Beethovens erst begriffen, als er dazu einen Potaufeu gegessen habe, zu Brahms empfahl er Kreuzworträtsel, auch Wiener Schnitzel seien möglich, zu Bruckner Jassen oder Pokern. Am besten jedoch sei es, gleich zwei Symphonien gleichzeitig laufen zu lassen. Das tat er denn auch angeblich. Des Getöses bewußt, das er entfesselte, hatte er für die drei übrigen Parteien des Hauses die Miete nach einem genau berechneten System ausgeklügelt. Die Wohnung unter seiner Wohndiele war die billigste, der Mieter hatte nichts zu bezahlen, nur Musik auszuhalten, stundenlang Bruckner, stundenlang Mahler, stundenlang Schostakowitsch, die mittlere Wohnung kostete das übliche, die unterste war beinahe unerschwinglich. Schönbächler war ein empfindsamer Mensch. Sein Äußeres wies nichts Besonderes auf, im Gegenteil, er schien Außenstehenden als der personifizierte Musterbürger. Er war sorgfältig gekleidet, roch angenehm und war nie betrunken, stand überhaupt mit der Welt auf bestem Fuß. Was seine Nationalität betrifft, so bezeichnete er sich als Liechtensteiner. Das stelle nicht viel dar, pflegte er dazu zu äußern, das gebe er zu, doch brauche er sich wenigstens nicht zu schämen: Liechtenstein sei an der gegenwärtigen Weltlage relativ schuldlos, sehe man davon ab, daß es zu viele Briefmarken drucke, und übersehe man seine finanziellen Kavaliersdelikte; es sei der kleinste Staat, der auf großem Fuße lebe. Auch unterliege ein Liechtensteiner nicht so leicht dem Größenwahn, sich einen besonderen Wert nur aus der Tatsache zuzuschreiben, daß er Liechtensteiner sei, wie dies etwa den Amerikanern, den Russen, Deutschen oder Franzosen zustoße, die a priori des Glaubens seien, ein Deutscher oder ein Franzose sei an sich ein höheres Wesen. Einer Großmacht anzugehören — und für einen Liechtensteiner seien notgedrungen fast alle anderen Staaten Großmächte, sogar die Schweiz —, bringe psychologisch für die davon Betroffenen einen bedenklichen Nachteil mit sich, die Gefahr nämlich, einem bestimmten Verhältnisblödsinn zu erliegen. Diese Gefahr wachse mit der Größe einer Nation. Er pflegte das an einem Mäusebeispiel zu erläutern: Eine Maus, die sich mit sich allein befinde, betrachte sich durchaus noch als Maus, sobald sie sich aber unter einer Million Mäusen wisse, halte sie sich für eine Katze und unter hundert Millionen Mäusen für einen Elefanten. Am gefährlichsten seien jedoch die Fünfzig-Millionen-Mäusevölker (fünfzig Millionen als Größenordnung). Diese beständen aus Mäusen, die sich zwar für Katzen hielten, aber gerne Elefanten wären. Dieser übersteigerte Größenwahn sei nicht nur für die davon betroffenen Mäuse gefährlich, sondern jeweils auch für die ganze Mäusewelt. Das Verhältnis jedoch zwischen der» Mäuseanzahl «und dem von dieser erzeugten Größenwahn nannte er das» Schönbächlersche Gesetz«. Als Beruf gab er Schriftsteller an. Das mochte insofern erstaunen, als er weder einmal etwas veröffentlicht noch je etwas geschrieben hatte. Er leugnete es nicht. Er nannte sich nur schlicht einen» potentiellen Schriftsteller«. Er war um eine Erklärung seines Nichtschreibens nie verlegen. So behauptete er gelegentlich, die Schriftstellerei beginne mit dem» Sinn für Namen«, das sei ihre primäre poetische Bedingung, dazu komme ihre nicht minder moralische, die in der Wahrheitsliebe begründet liege. Überdenke man nun diese beiden Grundbedingungen, so werde klar, daß zum Beispiel ein Titel, >Gedichte von Raoul Schönbächler<, allein schon durch die Vorstellung unmöglich gemacht würde, diese Lyrik müsse wie ein schönes Bächlein dahinplätschern. Man könne freilich einwenden, dann sei der Name Schönbächler zu ändern, doch dann komme man mit dem Prinzip der Wahrheitsliebe in Konflikt. Wo Schönbächler auftauchte, gab es zu lachen. Er war ein guter Kerl, von dem in den Gaststätten viele lebten. Die Zeche ließ er aufschreiben, man schickte ihm die Rechnung jeden Monat zu, was sich zusammenaddierte, mußte beträchtlich sein. Hinsichtlich seines Einkommens war man im unklaren. Seine Angaben über ein großzügiges liechtensteinisches Staatsstipendium konnten natürlich nicht stimmen. Einige behaupteten, er sei der Generalvertreter gewisser Gummiartikel. Auch war nicht zu übersehen, daß er vieles wußte und ein scharfes, stets sorgfältig begründetes Urteil besaß. (Vielleicht war sein Nicht-Schreiben nicht nur Faulheit, wie es schien, vielleicht steckte die Einsicht dahinter, es sei, im Gegensatz zu den vielen, die produzieren, besser, nichts zu produzieren.) Am berühmtesten war jedoch seine Fähigkeit, Gespräche anzuknüpfen, um so mehr als diese Kunst unseren Mitbürgern nicht liegt. Schönbächler dagegen beherrschte sie virtuos. Anekdoten wurden erzählt, Legenden bildeten sich. So soll er auf eine Wette hin (wie der Kommandant steif und fest behauptet) einen Bundesrat, der am Nebentisch mit Mitgliedern der Kantonsregierung beim Vieruhrtee saß, derart in ein Gespräch über die Beziehungen unseres Staates zu Liechtenstein verstrickt haben, daß der Magistrat den Schnellzug nach Bern verfehlt hätten. Möglich. Doch ist den Bundesräten im allgemeinen nicht so viel zuzutrauen. Schönbächler galt im übrigen als harmlos. Daß er Lienhards Agent war, ließ sich niemand träumen. Als es bekannt wurde, war die Bestürzung groß, Schönbächler verließ unsere Stadt und lebt nun mit seiner Diskothek in Südfrankreich, sehr zum Leidwesen unserer Mitbürger, erst letzthin drohte mir einer mit der Faust, zum Glück war ich mit Lucky. Dieses Original nun, Schönbächler, tauchte eines Tages im >Du Théâtre< auf, zur allgemeinen Verwunderung, denn er war sonst dort selten zu sehen. Er bezog einen Tisch und blieb den ganzen Tag. Am nächsten Morgen kam er aufs neue, so eine Woche lang, plauderte mit allen, befreundete sich mit dem Chef de Service und den Kellnerinnen, doch dann verschwand er, war wieder in den alten Stammbeizen anzutreffen, es war anscheinend ein Intermezzo gewesen. In Wirklichkeit hatte Schönbächler die Hauptzeugen noch einmal vernommen. Was jedoch die weiteren Recherchen betrifft, so benutzte Lienhard Feuchting, der zu jenen berüchtigten Elementen zählt, die er in seiner Detektei im Talacker beschäftigt, und den ich damals noch nicht kannte — erst jetzt kenne ich ihn (von der >Monaco-Bar<). Feuchting ist ein unzuverlässiger, übler Bursche, das kann niemand bestreiten, und auch Lienhard bestreitet es nicht, ebensowenig wie die Polizei, die Feuchting schon mehrere Male verhaftet hat (Rauschgift) und dann wieder selber für ihre Recherchen braucht. Feuchting ist ein Spitzel, der sein Metier und sein Milieu kennt. Möglich, daß er einst bessere Tage gesehen, möglich, daß er sogar studiert hat, der Rest, der sich nun durchs Leben pumpt, gaunert, erpreßt, ist erbärmlich. Sein Pech, sagte er (im >Monaco<) zu diesem Thema, trübselig in sein Glas Pernod stierend, sei, daß er kein Russe, sondern Deutscher sei. Deutscher sei hierzulande kein Beruf, möglicherweise in Ägypten oder Saudi-Arabien, hier sei nur Russe einer. Seine Existenz würde in diesem Falle keinen Anstoß erregen, im Gegenteil, als Russe wäre er geradezu verpflichtet, so zu sein, wie er sei: versoffen und ruiniert; aber nicht einmal den Russen zu spielen sei hier möglich, weil er so aussehe wie in französischen Resistance-Filmen ein Deutscher. In diesem Punkt spricht er die Wahrheit. Ausnahmsweise. Er sieht so aus. Er kennt die Ober- und Unterwelt wie kein zweiter, beherrscht die Bar- und Finten-Geographie. Er vermag über jeden Stammkunden jedes zu erfahren. Doch bevor mir Lienhard das von Schönbächler und Feuchting Ermittelte zuschickte, traf ich zum zweiten Mal mit Monika Steiermann zusammen, trat das ein, was ich befürchtet oder erhofft hatte — ich weiß es nicht mehr. Es wäre besser gewesen, die Begegnung hätte nicht stattgefunden (die erste wie die zweite).