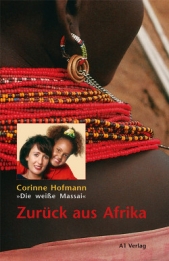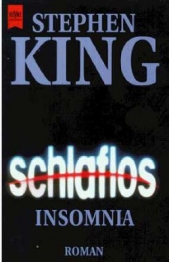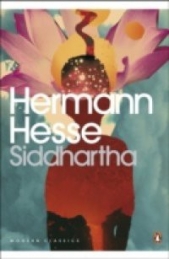Ansichten eines Clowns

Ansichten eines Clowns читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
24
Als das Telefon klingelte, war ich einige Augenblicke verwirrt. Ich hatte mich ganz darauf konzentriert, die Wohnungsklingel nicht zu überhören und Leo die Tür zu öffnen. Ich legte die Guitarre aus der Hand, starrte auf den klingelnden Apparat, nahm den Hörer auf und sagte: »Hallo«.
»Hans?« sagte Leo.
»Ja«, sagte ich, »schön, daß du kommst.« Er schwieg, hüstelte, ich hatte seine Stimme nicht sofort erkannt. Er sagte: »Ich habe das Geld für dich.« Das Geld klang seltsam. Leo hat überhaupt seltsame Vorstellungen von Geld. Er ist fast vollkommen bedürfnislos, raucht nicht, trinkt nicht, liest keine Abendzeitungen und geht nur ins Kino, wenn mindestens fünf Personen, denen er vollkommen vertraut, ihm den Film als sehenswert empfohlen haben; das geschieht alle zwei-drei Jahre. Er geht lieber zu Fuß als mit der Bahn zu fahren. Als er das Geld sagte, sank meine Stimmung sofort wieder. Wenn er gesagt hätte, etwas Geld, so hätte ich gewußt, daß es zwei bis drei Mark wären. Ich schluckte an meiner Angst und fragte heiser: »Wieviel?« — »Oh«, sagte er, »sechs Mark und siebzig Pfennige.« Das war für ihn eine Menge, ich glaube, für das, was man persönliche Bedürfnisse nennt, langte das für ihn auf zwei Jahre: hin und wieder eine Bahnsteigkarte, eine Rolle Pfefferminz, ein Groschen für einen Bettler, er brauchte ja nicht einmal Streichhölzer, und wenn er sich einmal eine Schachtel kaufte, um sie für »Vorgesetzte«, denen er Feuer geben mußte, griffbereit zu haben, dann kam er ein Jahr damit aus, und selbst wenn er sie ein Jahr lang mit sich herumtrug, sah sie noch wie neu aus. Natürlich mußte er hin und wieder zum Friseur gehen, aber das nahm er sicher vom »Studienkonto«, das Vater ihm eingerichtet hatte. Früher hatte er manchmal Geld für Konzertkarten ausgegeben, aber meistens hatte er von Mutter deren Freikarten bekommen. Reiche Leute bekommen ja viel mehr geschenkt als arme, und was sie kaufen müssen, bekommen sie meistens billiger, Mutter hatte einen ganzen Katalog vom Grossisten: ich hätte ihr zugetraut, daß sie sogar Briefmarken billiger bekam. Sechs Mark siebzig — das war für Leo eine respektable Summe. Für mich auch, im Augenblick — aber er wußte wahrscheinlich noch nicht, daß ich — wie wir es zu Hause nannten — »im Moment ohne Einnahmen« war.
Ich sagte: »Gut, Leo, vielen Dank — bring mir doch eine Schachtel Zigaretten mit, wenn du herkommst.« Ich hörte ihn hüsteln, keine Antwort, und fragte: »Du hörst mich doch? Wie?« Vielleicht war er gekränkt, daß ich mir gleich von seinem Geld Zigaretten mitbringen ließ. »Ja, ja«, sagte er, »nur...«, er stammelte, stotterte: »Es fällt mir schwer, es dir zu sagen — kommen kann ich nicht.«
»Was?« rief ich, »du kannst nicht kommen?«
»Es ist ja schon Viertel vor neun«, sagte er, »und ich muß um neun im Haus sein.«
»Und wenn du zu spät kommst«, sagte ich, »wirst du dann exkommuniziert?«
»Ach, laß das doch«, sagte er gekränkt.
»Kannst du denn nicht um Urlaub oder so etwas bitten?«
»Nicht um diese Zeit«, sagte er, »das hätte ich mittags machen müssen.«
»Und wenn du einfach zu spät kommst?«
»Dann ist eine strenge Adhortation fällig!« sagte er leise.
»Das klingt nach Garten«, sagte ich, »wenn ich mich meines Lateins noch erinnere.«
Er lachte ein bißchen. »Eher nach Gartenschere«, sagte er, »es ist ziemlich peinlich.«
»Na gut«, sagte ich, »ich will dich nicht zwingen, dieses peinliche Verhör auf dich zu nehmen, Leo — aber die Gegenwart eines Menschen würde mir guttun.«
»Die Sache ist kompliziert«, sagte er, »du mußt mich verstehen. Eine Adhortation würde ich noch auf mich nehmen, aber wenn ich diese Woche noch einmal zur Adhortation muß, kommt es in die Papiere, und ich muß im Scrutinium darüber Rechenschaft geben.«
»Wo?« sagte ich, »bitte, sags langsam.« Er seufzte, knurrte ein bißchen und sagte ganz langsam: »Scrutinium.«
»Verdammt, Leo«, sagte ich, »das klingt ja, als würden Insekten auseinandergenommen. Und >in die Papiere < — das ist ja wie in Annas 1.R.9. Da kam auch alles sofort in die Papiere, wie bei Vorbestraften.«
»Mein Gott, Hans«, sagte er, »wollen wir uns in den wenigen Minuten über unser Erziehungssystem streiten?«
»Wenns dir so peinlich ist, dann bitte nicht. Aber es gibt doch sicher Wege — ich meine Umwege, über Mauern klettern oder etwas ähnliches, wie beim 1.R.9. Ich meine, es gibt doch immer Lücken in so strengen Systemen.«
»Ja«, sagte er, »die gibt es, wie beim Militär, aber ich verabscheue sie. Ich will meinen geraden Weg gehen.«
»Kannst du nicht meinetwegen deinen Abscheu überwinden und einmal über die Mauer steigen?«
Er seufzte, und ich konnte mir vorstellen, wie er den Kopf schüttelte. »Hats denn nicht Zeit bis morgen? Ich meine, ich kann die Vorlesung schwänzen und gegen neun bei dir sein. Ist es so dringend? Oder fährst du gleich wieder los?«
»Nein«, sagte ich, »ich bleibe eine Zeitlang in Bonn. Gib mir wenigstens Heinrich Behlens Adresse, ich möchte ihn anrufen, und vielleicht kommt er noch rüber, von Köln, oder wo er jetzt sein mag. Ich bin nämlich verletzt, am Knie, ohne Geld, ohne Engagement — und ohne Marie. Allerdings werde ich morgen auch noch verletzt, ohne Geld, ohne Engagement und ohne Marie sein — es ist also nicht dringend. Aber vielleicht ist Heinrich inzwischen Pastor, hat ein Moped, oder irgend etwas. Hörst du noch?«
»Ja«, sagte er matt.
»Bitte«, sagte ich, »gib mir seine Adresse, seine Telefonnummer.«
Er schwieg. Das Seufzen hatte er schon raus, wie jemand, der hundert Jahre lang im Beichtstuhl gesessen und über die Sünden und Torheiten der Menschheit geseufzt hat.
»Na gut«, sagte er schließlich, mit hörbarer Überwindung, »du weißt also nicht?«
»Was weiß ich nicht«, rief ich, »mein Gott, Leo, sprich doch deutlich.«
»Heinrich ist nicht mehr Priester«, sagte er leise.
»Ich denke, das bleibt man, solange man atmet.«
»Natürlich«, sagte er, »ich meine, er ist nicht mehr im Amt. Er ist weggegangen, seit Monaten spurlos verschwunden.« Er quetschte das alles mühsam aus sich heraus.
»Na«, sagte ich, »er wird schon wieder auftauchen«, dann fiel mir etwas ein, und ich fragte: »Ist er allein?«
»Nein«, sagte Leo streng, »mit einem Mädchen weg.« Es klang, als hätte er gesagt: »Er hat die Pest auf dem Hals.«
Mir tat das Mädchen leid. Sie war sicherlich katholisch, und es mußte peinlich für sie sein, mit einem ehemaligen Priester jetzt irgendwo in einer Bude zu hocken und die Details des »fleischlichen Verlangens« zu erdulden, herumliegende Wäsche, Unterhosen, Hosenträger, Unterteller mit Zigarettenresten, durchgerissene Kinobilletts und beginnende Geldknappheit, und wenn das Mädchen die Treppe hinunterging, um Brot, Zigaretten oder eine Flasche Wein zu holen, machte eine keifende Wirtin die Tür auf, und sie konnte nicht einmal rufen: »Mein Mann ist ein Künstler, ja, ein Künstler.«
Mir taten sie beide leid, das Mädchen mehr als Heinrich. Die kirchlichen Behörden waren in einem solchen Fall, wenn es um einen nicht nur unansehnlichen, sogar schwierigen Kaplan ging, sicher streng. Bei einem Typ wie Sommerwild würden sie wahrscheinlich sämtliche Augen zudrücken. Er hatte ja auch keine Haushälterin mit gelblicher Haut an den Beinen, sondern eine hübsche, blühende Person, die er Maddalena nannte, eine ausgezeichnete Köchin, immer gepflegt und heiter.
»Na gut«, sagte ich, »dann fällt er vorläufig für mich aus.«
»Mein Gott«, sagte Leo, »du hast aber eine kaltschnäuzige Art, das hinzunehmen.«
»Ich bin weder Heinrichs Bischof noch ernsthaft an der Sache interessiert«, sagte ich, »nur die Details machen mir Kummer. Hast du denn wenigstens Edgars Adresse oder Telefonnummer?«