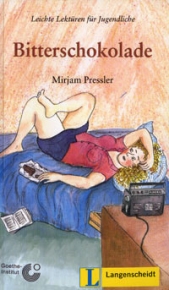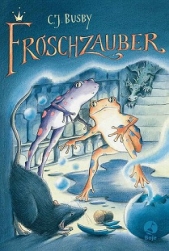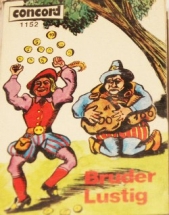Ecce homo. Wie man wird, was man ist

Ecce homo. Wie man wird, was man ist читать книгу онлайн
Ecce homo. Wie man wird, was man ist ist eine autobiographische Schrift des Philosophen Friedrich Nietzsche. Nietzsche arbeitete von Oktober 1888 bis zu seinem Zusammenbruch Anfang 1889 an dem Werk, das zum ersten Mal 1908 im Auftrag des Nietzsche-Archivs ver?ffentlicht wurde. Es ist nicht vollst?ndig ?berliefert und in seiner heute anerkannten Form erst seit den 1970ern bekannt.
In Ecce homo gibt Nietzsche r?ckblickend Deutungen seiner philosophischen Schriften und pr?sentiert sich selbst und seine Erkenntnisse als schicksalhafte Ereignisse von weltbewegender Gr??e. Dabei stehen die Themen seines Sp?twerks, besonders die Kritik am Christentum und die angek?ndigte „Umwertung aller Werte“, im Vordergrund.
Es gibt unterschiedliche Ansichten dar?ber, wie glaubw?rdig Nietzsches Darstellungen sind und wie sehr die Schrift bereits von seiner Geisteskrankheit beeinflusst ist. Dennoch sind Nietzsches Selbstdeutungen in Ecce homo oft als Ausgangspunkt f?r weitere biographische und philosophische Deutungen seines Werks genommen worden. Als letztes gr??eres Werk Nietzsches – die gleichzeitig entstandenen, kleineren Werke Nietzsche contra Wagner und Dionysos-Dithyramben sind im Wesentlichen aus ?lterem Material kompiliert – nimmt es in der Nietzsche-Rezeption eine Sonderstellung ein.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Also sprach Zarathustra.
Ein Buch für Alle und Keinen.
Ich erzähle nunmehr die Geschichte des Zarathustra. Die Grundconception des Werks, der Ewige-Wiederkunfts-Gedanke, diese höchste Formel der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann —, gehört in den August des Jahres 1881: er ist auf ein Blatt hingeworfen, mit der Unterschrift: »6000 Fuss jenseits von Mensch und Zeit«. Ich gieng an jenem Tage am See von Silvaplana durch die Wälder; bei einem mächtigen pyramidal aufgethürmten Block unweit Surlei machte ich Halt. Da kam mir dieser Gedanke. — Rechne ich von diesem Tage ein paar Monate zurück, so finde ich, als Vorzeichen, eine plötzliche und im Tiefsten entscheidende Veränderung meines Geschmacks, vor Allem in der Musik. Man darf vielleicht den ganzen Zarathustra unter die Musik rechnen; — sicherlich war eine Wiedergeburt in der Kunst zu hören, eine Vorausbedingung dazu. In einem kleinen Gebirgsbade unweit Vicenza, Recoaro, wo ich den Frühling des Jahrs 1881 verbrachte, entdeckte ich, zusammen mit meinem maëstro und Freunde Peter Gast, einem gleichfalls »Wiedergebornen«, dass der Phönix Musik mit leichterem und leuchtenderem Gefieder, als er je gezeigt, an uns vorüberflog. Rechne ich dagegen von jenem Tage an vorwärts, bis zur plötzlichen und unter den unwahrscheinlichsten Verhältnissen eintretenden Niederkunft im Februar 1883 — die Schlusspartie, dieselbe, aus der ich im Vorwort ein paar Sätze citirt habe, wurde genau in der heiligen Stunde fertig gemacht, in der Richard Wagner in Venedig starb — so ergeben sich achtzehn Monate für die Schwangerschaft. Diese Zahl gerade von achtzehn Monaten dürfte den Gedanken nahelegen, unter Buddhisten wenigstens, dass ich im Grunde ein Elephanten-Weibchen bin. — In die Zwischenzeit gehört die »gaya scienza«, die hundert Anzeichen der Nähe von etwas Unvergleichlichem hat; zuletzt giebt sie den Anfang des Zarathustra selbst noch, sie giebt im vorletzten Stück des vierten Buchs den Grundgedanken des Zarathustra. — Insgleichen gehört in diese Zwischenzeit jener Hymnus auf das Leben (für gemischten Chor und Orchester), dessen Partitur vor zwei Jahren bei E. W. Fritzsch in Leipzig erschienen ist: ein vielleicht nicht unbedeutendes Symptom für den Zustand dieses Jahres, wo das ja sagende Pathos par excellence, von mir das tragische Pathos genannt, im höchsten Grade mir innewohnte. Man wird ihn später einmal zu meinem Gedächtniss singen. — Der Text, ausdrücklich bemerkt, weil ein Missverständniss darüber im Umlauf ist, ist nicht von mir: er ist die erstaunliche Inspiration einer jungen Russin, mit der ich damals befreundet war, des Fräulein Lou von Salomé. Wer den letzten Worten des Gedichts überhaupt einen Sinn zu entnehmen weiss, wird errathen, warum ich es vorzog und bewunderte: sie haben Grösse. Der Schmerz gilt nicht als Einwand gegen das Leben: »Hast du kein Glück mehr übrig mir zu geben, wohlan! noch hast du deine Pein... « Vielleicht hat auch meine Musik an dieser Stelle Grösse. (Letzte Note der Oboe cis nicht c. Druckfehler.) — Den darauf folgenden Winter lebte ich in jener anmuthig stillen Bucht von Rapallo unweit Genua, die sich zwischen Chiavari und dem Vorgebirge Porto fino einschneidet. Meine Gesundheit war nicht die beste; der Winter kalt und über die Maassen regnerisch; ein kleines Albergo, unmittelbar am Meer gelegen, so dass die hohe See nachts den Schlaf unmöglich machte, bot ungefähr in Allem das Gegentheil vom Wünschenswerthen. Trotzdem und beinahe zum Beweis meines Satzes, dass alles Entscheidende »trotzdem«, entsteht, war es dieser Winter und diese Ungunst der Verhältnisse, unter denen mein Zarathustra entstand. — Den Vormittag stieg ich in südlicher Richtung auf der herrlichen Strasse nach Zoagli hin in die Höhe, an Pinien vorbei und weitaus das Meer überschauend; des Nachmittags, so oft es nur die Gesundheit erlaubte, umgieng ich die ganze Bucht von Santa Margherita bis hinter nach Porto fino. Dieser Ort und diese Landschaft ist durch die grosse Liebe, welche der unvergessliche deutsche Kaiser Friedrich der Dritte für sie fühlte, meinem Herzen noch näher gerückt; ich war zufällig im Herbst 1886 wieder an dieser Küste, als er zum letzten Mal diese kleine vergessne Welt von Glück besuchte. — Auf diesen beiden Wegen fiel mir der ganze erste Zarathustra ein, vor Allem Zarathustra selber, als Typus: richtiger, er überfiel mich...
Um diesen Typus zu verstehn, muss man sich zuerst seine physiologische Voraussetzung klar machen: sie ist das, was ich die grosse Gesundheit nenne. Ich weiss diesen Begriff nicht besser, nicht persönlicher zu erläutern, als ich es schon gethan habe, in einem der Schlussabschnitte des fünften Buchs der »gaya scienza«. »Wir Neuen, Namenlosen, Schlechtverständlichen — heisst es daselbst — wir Frühgeburten einer noch unbewiesenen Zukunft, wir bedürfen zu einem neuen Zwecke auch eines neuen Mittels, nämlich einer neuen Gesundheit, einer stärkeren gewitzteren zäheren verwegneren lustigeren, als alle Gesundheiten bisher waren. Wessen Seele darnach dürstet, den ganzen Umfang der bisherigen Werthe und Wünschbarkeiten erlebt und alle Küsten dieses idealischen »Mittelmeers« umschifft zu haben, wer aus den Abenteuern der eigensten Erfahrung wissen will, wie es einem Eroberer und Entdecker des Ideals zu Muthe ist, insgleichen einem Künstler, einem Heiligen, einem Gesetzgeber, einem Weisen, einem Gelehrten, einem Frommen, einem Göttlich-Abseitigen alten Stils: der hat dazu zu allererst Eins nöthig, die grosse Gesundheit — eine solche, welche man nicht nur hat, sondern auch beständig noch erwirbt und erwerben muss, weil man sie immer wieder preisgiebt, preisgeben muss ... Und nun, nachdem wir lange dergestalt unterwegs waren, wir Argonauten des Ideals, muthiger vielleicht als klug ist und Oft genug schiffbrüchig und zu Schaden gekommen, aber, wie gesagt, gesünder als man es uns erlauben möchte, gefährlich gesund, immer wieder gesund, — will es. uns scheinen, als ob wir, zum Lohn dafür, ein noch unentdecktes Land vor uns haben, dessen Grenzen noch Niemand abgesehn hat, ein jenseits aller bisherigen Länder und Winkel des Ideals, eine Welt so überreich an Schönem, Fremdem, Fragwürdigem, Furchtbarem und Göttlichem, dass unsre Neugierde sowohl als unser Besitzdurst ausser sich gerathen sind — ach, dass wir nunmehr durch Nichts mehr zu ersättigen sind! ... Wie könnten wir uns, nach solchen Ausblicken und mit einem solchen Heisshunger in Wissen und Gewissen, noch am gegenwärtigen Menschen. genügen lassen? Schlimm genug, aber es ist unvermeidlich, dass wir seinen würdigsten Zielen und Hoffnungen nun mit einem übel aufrecht erhaltenen Ernste zusehn und vielleicht nicht einmal mehr zusehn ... Ein andres Ideal läuft vor uns her, ein wunderliches, versucherisches, gefahrenreiches Ideal, zu dem wir Niemanden überreden möchten, weil wir Niemandem so leicht das Recht darauf zugestehn: das Ideal eines Geistes, der naiv, das heisst ungewollt und aus überströmender Fülle und Mächtigkeit mit Allem spielt, was bisher heilig, gut, unberührbar, göttlich hiess; für den das Höchste, woran das Volk billigerweise sein Werthmaass hat, bereits so viel wie Gefahr, Verfall, Erniedrigung oder, mindestens, wie Erholung, Blindheit, zeitweiliges Selbstvergessen bedeuten würde; das Ideal eines menschlich-übermenschlichen Wohlseins und Wohlwollens, welches oft genug unmenschlich erscheinen wird, zum Beispiel, wenn es sich neben den ganzen bisherigen Erdenernst, neben alle bisherige Feierlichkeit in Gebärde, Wort, Klang, Blick, Moral und Aufgabe wie deren leibhafteste unfreiwillige Parodie hinstellt — und mit dem, trotzalledem, vielleicht der grosse Ernst erst anhebt, das eigentliche Fragezeichen erst gesetzt wird, das Schicksal der Seele sich wendet, der Zeiger rückt, die Tragödie beginnt.
— Hat jemand, Ende des neunzehnten Jahrhunderts, einen deutlichen Begriff davon, was Dichter starker Zeitalter Inspiration nannten? Im andren Falle will ich's beschreiben. Mit dem geringsten Rest von Aberglauben in sich würde man in der That die Vorstellung, bloss Incarnation, bloss Mundstück, bloss medium übermächtiger Gewalten zu sein, kaum abzuweisen wissen. Der Begriff Offenbarung, in dem Sinn, dass plötzlich, mit unsäglicher Sicherheit und Feinheit, Etwas sichtbar, hörbar wird, Etwas, das Einen im Tiefsten erschüttert und umwirft, beschreibt einfach den Thatbestand. Man hört, man sucht nicht; man nimmt, man fragt nicht, wer da giebt; wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf, mit Nothwendigkeit, in der Form ohne Zögern, — ich habe nie eine Wahl gehabt. Eine Entzükkung, deren ungeheure Spannung sich mitunter in einen Thränenstrom auslöst, bei der der Schritt unwillkürlich bald stürmt, bald langsam wird; ein vollkommnes Ausser-sich-sein mit dem distinktesten Bewusstsein einer Unzahl feiner Schauder und Überrieselungen bis in die Fusszehen; eine Glückstiefe, in der das Schmerzlichste und Düsterste nicht als Gegensatz wirkt, sondern als bedingt, als herausgefordert, sondern als eine nothwendige Farbe innerhalb eines solchen Lichtüberflusses; ein Instinkt rhythmischer Verhältnisse, der weite Räume von Formen überspannt — die Länge, das Bedürfniss nach einem weitgespannten Rhythmus ist beinahe das Maass für die Gewalt der Inspiration, eine Art Ausgleich gegen deren Druck und Spannung ... Alles geschieht im höchsten Grade unfreiwillig, aber wie in einem Sturme von Freiheits-Gefühl, von Unbedingtsein, von Macht, von Göttlichkeit ... Die Unfreiwilligkeit des Bildes, des Gleichnisses ist das Merkwürdigste; man hat keinen Begriff mehr, was Bild, was Gleichniss ist, Alles bietet sich als der nächste, der richtigste, der einfachste Ausdruck. Es scheint wirklich, um an ein Wort Zarathustra‘s zu erinnern, als ob die Dinge selber herankämen und sich zum Gleichnisse anböten (- »hier kommen alle Dinge liebkosend zu deiner Rede und schmeicheln dir: denn sie wollen auf deinem Rücken reiten. Auf jedem Gleichniss reitest du hier zu jeder Wahrheit. Hier springen dir alles Seins Worte und Wort-Schreine auf; alles Sein will hier Wort werden, alles Werden will von dir reden lernen —«). Dies ist meine Erfahrung von Inspiration; ich zweifle nicht, dass man Jahrtausende zurückgehn muss, um jemanden zu finden, der mir sagen darf »es ist auch die meine«.