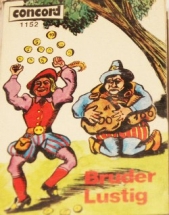Die geheime Reise der Mariposa

Die geheime Reise der Mariposa читать книгу онлайн
Alles drin! Der Schm?kertipp Sch?tze, Geheimnisse und gro?e Dramatik Fast schon ist es zu sp?t, als Jos? Jonathan aus den Wellen des Pazifiks rettet und auf sein Schiff, die "Mariposa", bringt. Obwohl Jonathans Vergangenheit im Dunkel liegt, freunden die beiden sich an und Jonathan begleitet Jos? auf seiner Reise zur d?steren Isla Maldita. Dort hoffen sie herauszufinden, wohin die r?tselhafte Karte weist, die Jos? bei sich tr?gt. Doch auch die M?nner, die die beiden erbarmungslos ?ber das Meer verfolgen, haben es auf die Karte abgesehen. Welcher Schatz ist auf der Insel verborgen? Und welches Geheimnis verbirgt Jonathan? Ein pralles Abenteuer spannend und voller Action, inmitten von St?rmen, Wellen, Vulkanen und der faszinierenden Tierwelt S?damerikas.
Antonia Michaelis,Jahrgang 1979, in Norddeutschland geboren, in S?ddeutschland aufgewachsen, zog es nach dem Abitur in die weite Welt. Sie arbeitete u.a. in S?dindien, Nepal und Peru. In Greifswald studierte sie Medizin und begann parallel dazu, Geschichten f?r Kinder und Jugendliche schreiben. Seit einigen Jahren lebt sie als freie Schriftstellerin in der N?he der Insel Usedom und hat bereits zahlreiche Kinder und Jugendb?cher ver?ffentlicht, facettenreich, fantasievoll und mit gro?em Erfolg. Ihr erstes Buch f?r junge Erwachsene war »Der M?rchenerz?hler«, zugleich fesselnder Psychothriller und zu Herzen gehende Liebesgeschichte. Antonia Michaelis berichtet in einem Weblog auf www.oetinger.de mit viel Witz und Esprit ?ber ihren Alltag als Autorin. Sehens- und lesenswert ist auch die Website der Autorin www.antonia-michaelis.de.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Doch Jonathan drückte die Ratte an sich wie einen Schatz. »Das Leben kommt von Gott«, sagte er mit einem leisen Lächeln. »Auch das Leben einer Ratte. Lernt ihr keine Gottesfurcht, da, wo du herkommst?«
José knurrte. »Carmen«, sagte er dann.
Sie erreichten Santiago, als der Abend kam. Es war ein Tag voller Schweigen gewesen. Jonathans Schweigsamkeit war wie eine Mauer, gegen die José nicht ankam. Er wünschte, er hätte noch ein Dutzend Ratten unter Deck gefunden, damit Jonathan über sie lachen konnte, doch Carmen blieb der einzige blinde Passagier. Sie hatte sich mit etwas Brot füttern lassen und war offenbar jetzt damit beschäftigt, unter Deck aufzuräumen. Ab und zu hörte man etwas hinunterfallen.
José versuchte die Sullivan Bay anzulaufen. Er kannte die Bucht aus Erzählungen: Sie war ein einziges Feld aus dunklen, übereinandergelegten Stricken schwarzer Lava, die wirkten wie riesige Taue. Wo Gasblasen die oberste Lavaschicht zum Aufplatzen gebracht hatten, gab es Löcher in der Lava: Hornitos, längst erkaltete Gesteinsformen. Sie sahen aus wie Augen. José schüttelte sich unwillkürlich.
»Auf der anderen Seite der Insel gibt es Siedler«, sagte er. »Angeblich. Du wirst jemanden finden, der dir weiterhilft.«
Jonathan antwortete nicht. Und dann drehte der Wind und drückte die Mariposa von Santiago fort.
»Es wäre einfacher, eine der beiden Buchten da drüben anzulaufen«, sagte Jonathan und zeigte zur anderen Seite.
José schnaubte. »Das ist Bartolomé. Eine winzige Insel. Da gibt es keine Menschen. Was willst du dort?«
»Das weißt du genau«, sagte Jonathan. »Und du weißt auch, dass ich dazu keine Menschen brauche. Steure uns nach Bartolomé.«
José seufzte und wendete die Mariposa. Er war inzwischen zu müde, um zu diskutieren. Er musste sich eine Weile auf festem Boden ausstrecken und schlafen. Im Abendlicht glichen die sandigen Zwillingsbuchten von Bartolomé den Flügeln einer Möwe. In ihrer Mitte reckte sich steil eine schwarze Felsspitze in die Höhe wie ein Schnabel.
»Pinnacle Rock«, sagte José laut. Die Amerikaner hatten von diesem Felsen gesprochen, und auch seine Brüder, hinter vorgehaltener Hand. Als wäre der schwarze Stein etwas Lebendiges, etwas Unberechenbares, etwas Gefährliches. José spürte, dass die Abuelita etwas sagen wollte, und verbot ihr den Mund. Er übergab Jonathan noch einmal das Steuer, kletterte nach vorn, um den Anker auszuwerfen und die Segel einzuholen. Trotz der Müdigkeit fühlte sich jeder Handgriff leicht und eingeübt an, als hätte José sein Leben lang nichts anderes getan, als die Mariposa zu segeln. Aber der Schatten von Pinnacle Rock war tief und dunkel, und seine Spitze streifte die honiggelbe Flanke des Schiffs wie eine Drohung.
Das Wasser war hier nicht tief, es ging José nur bis zur Hüfte. Er half Jonathan beim Hinunterklettern und spürte einmal mehr, wie schmächtig er war. »Wenn du ins Meer hinausschwimmst, wie willst du je darin versinken?«, sagte José mit einem unpassenden Lächeln. »Du hast kein Gewicht, dass, dich in die Tiefe zieht.«
»Wir werden sehen«, sagte Jonathan.
Dann wateten sie an Land. Dort blieben sie stehen und sahen sich an, und schließlich streckte Jonathan seine Hand aus. Er schüttelte Josés Hand stumm zum Abschied. José wollte tausend Dinge sagen. Er wusste, dass keines der tausend Dinge Jonathan umstimmen konnte. So legte er sich in den weißen Sand, schloss für einen Moment die Augen und bemühte sich, nicht daran zu glauben, dass dieser Verrückte wirklich versuchen würde zu sterben. Er bemühte sich mit solcher Konzentration, dass er darüber einschlief.
Im Traum segelte er auf der Mariposa über das Meer bis nach London. José wusste, dass es London war, denn am Ufer stand Jonathan und winkte mit einer englischen Flagge. Auf seiner Schulter saß Carmen, die Reisratte, und mitten in der Flagge war ein Loch. »Das hat jemand mit der Pistole hineingeschossen!«, rief Jonathan in Josés Traum vom Ufer aus. »Aber wer? Wem gehört sie?«
Früher hatte Jonathan gedacht, die Inseln wären von Anfang an grün: Man setzte seinen Fuß darauf und befand sich im Urwald, wo Millionen von großen bunten Blüten an den Bäumen wuchsen und ihren süßlichen Duft verströmten. Isabela war nicht von Anfang an grün gewesen. Und auch hier lag nur vertrocknetes, sonnenverbranntes Land hinter dem Strand. Sein eigener Schatten zeichnete sich mit brutaler Schärfe auf dem Boden ab.
Er folgte einem vor langer Zeit ausgetretenen Pfad zwischen niedrigen Büschen hindurch – und trat beinahe auf das Nest eines Blaufußtölpels. Ein Stück weiter sonnte sich eine Schlange auf einem Stein, zwei Eidechsen huschten davon und ein träger gelber Landleguan beäugte Jonathan mit einem Blick voll gutmütiger Langeweile.
»Du hattest recht«, flüsterte Jonathan. »Mama, du hattest recht. Sie lassen sich von einem dummen Menschen nicht stören. Wenn du nur hier wärst und sie sehen könntest! Die Tiere, und auch die Pflanzen. Sie werden höher und grüner, je weiter man sich vom Ufer entfernt …«
Und da beschloss Jonathan, auf den schwarzen Felsen am Rand der Bucht zu steigen, um die Insel von dort aus zu betrachten: als könnte er sie seiner Mutter zeigen, indem er sie selbst sah. Vielleicht konnte er ihr davon erzählen. Er würde ihr bald begegnen, nicht wahr? Sobald er den Mut fand, noch einmal ins Wasser zu gehen.
Er kehrte zurück zum einen Ende des Strands, kletterte über spitze Lavasteine und verfluchte seine bloßen Füße. Und dann sah er hinunter zum Wasser und entdeckte die Pinguine. Sie waren kleiner und unscheinbarer als ihre schwarz-weißen Verwandten vom Südpol, sie trugen einen schlichten Anzug mit bräunlich gesprenkelter Brust und keinen schwarzen Frack. Dennoch waren es unzweifelhaft Pinguine. Sie spielten im Wasser zwischen den schwarzen Felsen wie Kinder, pfeilschnell, fischschnell. Doch die, die an Land kamen, verloren ihre Eleganz. Sie watschelten langsam und schwankend über die Steine: wie eine Reisegruppe aus älteren Herrschaften, die auf dem Kreuzfahrtschiff ein Gläschen Sekt zu viel getrunken hatten. Er merkte, wie sich ein Grinsen in sein Gesicht stahl. Mama, dachte er, hätte laut gelacht.
Ein paar der Pinguine schienen die Köpfe zusammenzustecken, um über etwas zu tuscheln. Nein, sie hatten sich über etwas gebeugt, das am Boden lag. Einen weiteren Pinguin. Jonathan schluckte. War er tot? Oh, wie satt er den Tod hatte! Er schlich sich überall ein, selbst in den Momenten, in denen man lachen wollte … Dann sah er, wie der Pinguin einen Flügel bewegte, hilflos, schwach, aber lebendig. Jonathan kletterte schneller über die spitzen Steine hinunter, als er es für möglich gehalten hatte.
Als er sich neben den Vogel kniete, wichen die anderen zurück und sahen ihn aus verwunderten Knopfaugen an. Blut hatte das helle Gefieder des Pinguins dunkel verfärbt. Er hatte eine große Wunde an der einen Flanke und offenbar konnte er den Flügel auf dieser Seite nicht bewegen. Es sah aus, als hätte jemand etwas nach ihm geworfen. Einen der scharfkantigen Steine, die hier herumlagen.
»Aber wer?«, wisperte Jonathan. »Wer hat das getan? Weshalb?«
Behutsam hob er den Pinguin hoch und hielt ihn im Arm wie ein Kind. Die blanken Augen des Vogels fanden seine und er las eine Bitte darin: Hilf mir, bat der Pinguin. Es war ein höflicher Pinguin. Wenn du mich hier liegen lässt, werde ich sterben. Es macht nichts aus, denn überall sterben Tiere, jeden Tag, es gehört dazu. Aber mir persönlich würde es doch etwas ausmachen.
»Natürlich«, flüsterte Jonathan. »Natürlich helfe ich dir. Vielleicht gibt es auf der Mariposa etwas, um die Wunde zu säubern. Alkohol. Und Verbandszeug. Ich werde José fragen. Ich …«
Der Pinguin drehte den Kopf und sah aufs Meer hinaus, und Jonathan folgte seinem Blick.
Dort näherte sich vor der sinkenden Sonne von Westen her ein Schiff. Es war größer als die Mariposa, und obwohl er die Farbe nicht genau erkennen konnte, schien es ihm grau. Militärgrau. Jonathan duckte sich instinktiv hinter einen Felsbrocken.