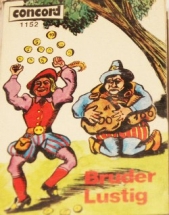Die geheime Reise der Mariposa

Die geheime Reise der Mariposa читать книгу онлайн
Alles drin! Der Schm?kertipp Sch?tze, Geheimnisse und gro?e Dramatik Fast schon ist es zu sp?t, als Jos? Jonathan aus den Wellen des Pazifiks rettet und auf sein Schiff, die "Mariposa", bringt. Obwohl Jonathans Vergangenheit im Dunkel liegt, freunden die beiden sich an und Jonathan begleitet Jos? auf seiner Reise zur d?steren Isla Maldita. Dort hoffen sie herauszufinden, wohin die r?tselhafte Karte weist, die Jos? bei sich tr?gt. Doch auch die M?nner, die die beiden erbarmungslos ?ber das Meer verfolgen, haben es auf die Karte abgesehen. Welcher Schatz ist auf der Insel verborgen? Und welches Geheimnis verbirgt Jonathan? Ein pralles Abenteuer spannend und voller Action, inmitten von St?rmen, Wellen, Vulkanen und der faszinierenden Tierwelt S?damerikas.
Antonia Michaelis,Jahrgang 1979, in Norddeutschland geboren, in S?ddeutschland aufgewachsen, zog es nach dem Abitur in die weite Welt. Sie arbeitete u.a. in S?dindien, Nepal und Peru. In Greifswald studierte sie Medizin und begann parallel dazu, Geschichten f?r Kinder und Jugendliche schreiben. Seit einigen Jahren lebt sie als freie Schriftstellerin in der N?he der Insel Usedom und hat bereits zahlreiche Kinder und Jugendb?cher ver?ffentlicht, facettenreich, fantasievoll und mit gro?em Erfolg. Ihr erstes Buch f?r junge Erwachsene war »Der M?rchenerz?hler«, zugleich fesselnder Psychothriller und zu Herzen gehende Liebesgeschichte. Antonia Michaelis berichtet in einem Weblog auf www.oetinger.de mit viel Witz und Esprit ?ber ihren Alltag als Autorin. Sehens- und lesenswert ist auch die Website der Autorin www.antonia-michaelis.de.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Jonathan nickte stumm.
»Na«, sagte er, »es ist auch für mich die erste Tour auf einem so kleinen Schiff. Und für Oskar.« Er schüttelte etwas Kleines, Braunes aus seinem Ärmel, das empört quiekte. »Nur bei Carmen wäre ich mir nicht so sicher.«
»Wenn ihr trotzdem mitkommen wollt …«, sagte José. Niemand widersprach. »Dann gehe ich jetzt ein letztes Mal an Land«, fuhr José fort. »Von hier aus kann man vermutlich nach Santiago schwimmen.« Er verschwand unter Deck, und als er diesmal wieder auftauchte, trug er ein Gewehr über der Schulter. Jonathan wich zurück.
»Was willst du denn damit?«, fragte er.
»Einen Vogel schießen«, antwortete José. »Oder ein wildes Schwein. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, frisches Fleisch an Bord zu nehmen. Vielleicht finden wir auf Marchena keins.« Er legte das Gewehr an und zielte auf einen Punkt am Horizont. »Eines Tages«, sagte er, »ziehe ich nach Europa und knalle die Deutschen alle ab.«
»Warum?«, fragte Jonathan zögernd.
José bewegte das Gewehr und auf einmal zielte sein Lauf auf Jonathan. Er spürte, wie sich alles in ihm verkrampfte. Wusste José, wer er war?
»Weil ich sie hasse«, sagte José. »Ich hasse alle Deutschen. Alle.«
Hatte er seinen Akzent erkannt? Jonathan überlegte, was er tun würde, wenn José abdrückte. Nichts vermutlich. Fallen. Vielleicht schreien.
»Sie haben den Krieg gemacht«, fuhr José fort. »Sie sind schuld, dass deine Mutter tot ist und deine Schwester. Hasst du sie nicht?«
»Ich … nein … doch.« Jonathan merkte, wie sehr seine Stimme zitterte. José wusste gar nichts. Gar nichts. Er spielte nur mit seinem dummen Gewehr. Aber wenn du jemanden abknallen willst, magst du den Krieg, wollte er sagen. Du bist ja wie sie! Er sagte es nicht. Er sagte: »Dann geh und schieß deinen Vogel. Aber beeil dich. Vielleicht kommt die Roosevelt noch einmal zurück, um nach uns zu suchen. Weshalb auch immer.«
»Ach was«, sagte José, »die ist längst weit weg. Warte hier auf mich. Lass die Mariposa nicht allein, hörst du? Auf keinen Fall. Ich bin bald wieder da.«
Kurz darauf beobachtete Jonathan, wie José, das Gewehr mit einer Hand über den Kopf haltend, ans Ufer schwamm. Als er dort ankam, winkte er. Mit dem Gewehr.
»Loco«, sagte er leise. »Ein Verrückter. Wenn auch nicht halb so verrückt wie die Idee, von Hamburg auf die Galapagosinseln auszuwandern.« Aber vielleicht, dachte er, war auch sein Onkel nicht so verrückt gewesen, wie alle geglaubt hatten. Vielleicht hatte seine Idee, auszuwandern, überhaupt nichts mit Jonathans Mutter und ihrem Traum zu tun gehabt.
Thomas Waterweg war durch und durch deutsch. Ein Nationalsozialist. Einer von jenen, die glaubten, die Welt gehörte den Deutschen, den blonden blauäugigen Deutschen und niemandem sonst. »Eine lächerlich dumme Idee«, hatte Jonathans Mutter gesagt, »so lächerlich, dass man kaum glauben kann, dass ein Weltkrieg daraus entstanden ist.«…Aber das hatte sie nur leise gesagt und auch nur zu Hause, wo niemand sie hörte. Thomas, ihr Bruder, hatte den Krieg bisher von seinem Schreibtisch aus mitverfolgt. Er hatte Kontakte. So gute Kontakte, dass er nicht eingezogen worden war.
Und hier hatten die Amerikaner also eine Militärbasis auf Baltra, von der aus sie den Panamakanal kontrollierten. Es gab sicherlich eine Menge Leute in Deutschland, die genauere Informationen über jene Militärbasis durchaus interessant gefunden hätten.
Nein, dachte Jonathan, sein Onkel hatte den sicheren Schreibtisch nicht verlassen, um aus einer Laune heraus quer über den Pazifik zu fahren. Er war gekommen, um auf Baltra für die Deutschen zu spionieren.
Jonathan streichelte gedankenverloren den Pinguin Oskar, der den Kopf vertrauensvoll in seine Hand gelegt hatte. »Und vermutlich war es praktisch, auf der Reise einen netten kleinen Jungen bei sich zu haben, zur Tarnung«, sagte er zu Oskar, auf Deutsch. Pinguine verstanden alle Sprachen der Welt, das war bekannt. »Wer verdächtigt einen Onkel, der mit einem netten kleinen Jungen und einem englischen Pass aus Europa flieht? Nun, der nette kleine Junge ist ihm abhandengekommen. Er ist unterwegs mit einem, der alle Deutschen hasst, auf dem Schiff eines Toten, in dessen Kajüte plötzlich Pistolen auftauchen.«
In diesem Moment tauchte noch etwas auf. Es tauchte in einer der Lücken zwischen den Felsen auf, durch die Jonathan hinaus aufs Meer sehen konnte, und es war ein Schiff. Ein grauer Militärsegler. Die Roosevelt war zurückgekommen. Er beobachtete mit rasendem Puls, wie sie näher kam, wie sie sich der Küste näherte – und atmete auf, als sie einige Hundert Meter entfernt vor einem anderen Felsen ihre Fahrt stoppte, einem flachen Felsen, über den man die Insel trockenen Fußes erreichen konnte. Dort machten die Männer das Schiff mit einem dicken Tau fest, das sie um ein Stück des Felsens schlangen: Sie hatten einen natürlichen Hafen gefunden. Aber sie waren nicht gekommen, weil sie einen besonders hübschen Hafen gesucht hatten. Sie waren gekommen, weil sie etwas anderes suchten. Etwas, das ihnen entkommen war.
Er sah ihre Uniformen, und er fragte sich nicht zum ersten Mal, warum Männer in amerikanischer Uniform hinter José her waren: José, der die Amerikaner vergötterte, der so gern mit ihnen in den Krieg gezogen wäre … Er sah, wie sie zielstrebig die Küste hinaufgingen. Über ihren Schultern lagen Gewehre.
Jonathan war sich jetzt sicher, dass sie die Mariposa in ihrem Versteck nicht gesehen hatten. Aber vielleicht hatten sie etwas anderes gesehen. Vielleicht hatten sie José gesehen, wie er im Unterholz verschwunden war.
Die Hitze im Inneren der Insel umgab José wie ein lebendiges Wesen. Sie waberte zwischen den niedrigen Büschen und Farnen umher, schloss ihn ein und setzte sich auf ungewohnte Weise in seine Lungen. Schon zwei Tage auf dem Wasser hatten ihn die Hitze beinahe vergessen lassen.
Während der letzten Monate hatte sich die graue Geisterlandschaft der Küsten in einen großblättrigen Streifen niedrigen Grüns verwandelt, aber es wuchsen nur wenige Bäume darin, die Schatten spendeten. Er sah zum Himmel. Der Regen blieb seit zwei Wochen aus.
Die Wolken, die in den letzten Nächten das Mondlicht gestohlen hatten, waren weitergezogen, ohne abzuregnen. José dachte an die Farm zu Hause und an Mama Carmelita, die ebenfalls auf den Regen wartete. Dann dachte er an die Wasserkanister auf der Mariposa. Wenn es nicht mehr regnete, würde das Wasser nicht ausreichen. Nicht für zwei Leute …
Es raschelte vor ihm im Gebüsch und er blieb stehen. Ein Leguan tauchte aus den Sträuchern auf, reckte den gelben Kopf und sah José erwartungsvoll an, wie ein Hund, der auf ein Stück Wurst hoffte. José lächelte erleichtert. »Ich habe nichts für dich«, sagte er. »Ich kenne euch Bettler von zu Hause. Verschwinde!«
In diesem Moment raschelte es wieder, näher diesmal, und eine panische Explosion aus bunten Federn brach neben José aus dem Unterholz. Etwas war durch den Wald unterwegs, etwas Großes, das die anderen Tiere erschreckte. José sah sich um. Er musste ein ganzes Stück gestiegen sein. Hier gab es mehr Grün, lange Bartflechten bedeckten die Guavenbäume. Zwischen den bemoosten Stämmen raschelte es noch einmal. Was da raschelte, befand sich hinter einem dichten Gestrüpp voll weißer Blüten. »Schicksalsbäume« hießen die Pflanzen bei den Leuten von den Inseln. José nahm das Gewehr von der Schulter.
Vorsichtig teilte er die Zweige und pirschte sich hindurch, das Gewehr im Anschlag. Was da vor ihm Äste brach und Blätter zertrat, besaß die ungefähre Größe und Höhe eines Menschen. War einer der Siedler von der anderen Seite der Insel hier im Wald unterwegs?
Nein, sagte sich José, vermutlich handelte es sich um ein Tier. Ein Tier, das er schießen konnte. Er schlüpfte unter den letzten weiß blühenden Zweigen hindurch und stand auf einer Lichtung. Schwarze Lavafelsen säumten sie, überwuchert von den grünen Ranken und den faustgroßen duftenden Blüten einer Passionsblume. Und mitten auf der Lichtung stand das, was geraschelt hatte, und sah José entgegen.