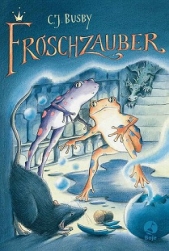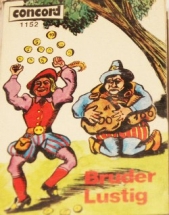Narzi? und Goldmund

Narzi? und Goldmund читать книгу онлайн
Hermann Hesses Erz?hlung ?ber den Gegensatz zwischen Geist- und Sinnenmenschen und ihre produktive Vereinigung im K?nstler ist eine moderne Gestaltung des Don-Juanund Casanova-Motivs. Sie ist aber auch ein Loblied der Freundschaft, voller Abenteuer in einem zeitlosen Mittelalter. Kl?sterlicher und st?dtischer Kunstbetrieb, Zigeunerm?dchen und Vagantenpoesie: »Alle diese Elemente deutsch-romantischer Erz?hlkunst vereinen sich hier in seltener Vollst?ndigkeit« (Rolf Schneider). Jahre bevor der Nationalsozialismus die kulturellen Traditionen Deutschlands mi?brauchte, hat Hesse in diesem Roman die Idee von Deutschland und deutschem Wesen, die er seit seiner Kindheit in sich trug, dargestellt und ihr seine »Liebe gestanden, gerade weil ich alles, was heute spezifisch deutsch ist, so sehr hasse«, schrieb er 1933. Zu Hesses Lebzeiten war Narzi? und Goldmund das erfolgreichste seiner B?cher. Die deutsche Gesamtauflage von 1930 bis heute betr?gt mehr als zwei Millionen Exemplare. ?bersetzt ist der Roman mittlerweile in drei?ig Sprachen.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
»Rebekka«, sagte er, »du siehest doch, daß ich es nicht schlimm mit dir meine. Du bist betrübt, du denkst an deinen Vater, du willst jetzt nichts von Liebe wissen. Aber morgen oder übermorgen oder später werde ich dich wieder fragen, und bis dahin beschütze ich dich und bringe dir zu essen und rühre dich nicht an. Sej du traurig, solange es nötig ist. Du sollst bei mir traurig sein können oder fröhlich, du sollst immer nur das tun, was dir Freude macht.«
Aber alles war in den Wind geredet. Sie wolle nichts tun, sagte sie verbissen und wütend, was Freude mache, sie wolle tun, was Schmerzen bringe, nie mehr werde sie an etwas wie Freude denken, und je eher der Wolf sie fräße, desto besser sei es für sie. Er solle nun gehen, es helfe nichts, es sei schon zuviel geredet.
»Du«, sagte er, »siehst du denn nicht, daß überall der Tod ist, daß in allen Häuseen und Städten gestorben wird und alles voll von Jammer ist. Auch die Wut der dummen Menschen, die deinen Vater verbrannt haben, ist nichts als Not und Jammer, sie kommt nur aus allzu großem Leiden. Schau, bald holt auch uns der Tod, und wir verfaulen im Feld, und mit unseren Knochen würfelt der Maulwurf. Laß uns vorher noch leben und lieb miteinander sein. Ach du, es wäre so schade um deinen weißen Hals und um deinen kleinen Fuß! Liebes schönes Mädchen, komm mit mir, ich rühre dich nicht an, ich will dich nur sehen und für dich sorgen.«
Er flehte noch lange und fühlte plötzlich selbst, wie nutzlos es sei, mit Worten und Gründen zu werben. Er schwieg und sah sie traurig an. Ihr stolzes königliches Gesicht war starr vor Abweisung.
»So seid ihr«, sagte sie endlich mit einer Stimme voll Haß und Verachtung, »so seid ihr Christen! Erst hilfst du einer Tochter ihren Vater begraben, den deine Leute gemordet haben und dessen letzter Fingernagel mehr wert ist als du, und kaum ist es getan, so soll das Mädchen dir gehören und mit dir buhlen gehen. So seid ihr! Zuerst dachte ich, vielleicht seiest du ein guter Mensch. Aber wie solltest du gut sein! Ach, ihr seid Säue.«
Während sie sprach, sah Goldmund in ihren Augen, hinter dem Haß, etwas glühen, was ihn rührte und beschämte und ihm tief zu Herzen ging. Er sah in ihren Augen den Tod, aber nicht das Sterbenmüssen, sondern das Sterbenwollen, das Sterbendürfen, die stille Gefolgschaft und Hingabe an den Ruf der Erdenmutter.
»Rebekka«, sagte er leise, »du hast vielleicht recht. Ich bin kein guter Mensch, obwohl ich es mit dir gut gemeint habe. Verzeih mir. Ich habe dich erst jetzt verstanden.«
Mit gezogener Mütze grüßte er sie tief wie eine Fürstin und ging davon, schweren Herzens; er mußte sie untergehen lassen. Lange blieb er betrübt und mochte mit niemand sprechen. So wenig sie einander glichen, so erinnerte dies stolze arme Judenkind ihn doch auf irgendeine Art an Lydia, die Tochter des Ritters. Es brachte Leiden, solche Frauen zu lieben. Aber eine Weile schien es ihm so, als habe er niemals eine andere geliebt als diese beiden, die arme ängstliche Lydia und die scheue bittere Jüdin.
Noch manchen Tag dachte er an das schwarze glühende Mädchen und träumte manche Nacht von der schlanken brennenden Schönheit ihres Leibes, die zu Glück und Blüte bestimmt schien und doch schon dem Sterben ergeben war. O daß diese Lippen und Brüste den »Säuen« zur Beute werden und im Felde verwesen sollten! Gab es denn keine Macht, keinen Zauber, diese kostbaren Blüten zu retten? Ja, es gab einen solchen Zauber: daß sie in seiner Seele weiterlebten und von ihm gestaltet und aufbewahrt würden. Mit Schrecken und mit Entzücken fühlte er, wie voll von Bildern seine Seele war, wie dies lange Wandern durch das Todesland ihn mit Figuren vollgeschrieben hatte. O wie spannte diese Fülle in seinem Innern, wie sehnlich verlangte ihn danach, sich still auf sie zu besinnen, sie abströmen zu lassen und in bleibende Bilder zu verwandeln! Glühender und begieriger strebte er weiter, noch immer mit offenen Augen und neugierigen Sinnen, aber voll heftiger Sehnsucht nach Papier und Stift, nach Ton und Holz, nach Werkstatt und Arbeit.
Der Sommer war vorüber. Viele versicherten, daß mit dem Herbst oder doch mit dem Winteranfang die Seuche aufhören werde. Es war ein Herbst ohne Fröhlichkeit. Goldmund kam durch Gegenden, in denen niemand mehr da war, das Obst zu ernten, es fiel von den Bäumen und faulte im Gras; an anderen Orten wurde es von verwilderten Horden, die aus den Städten kamen, in rohen Raubzügen geplündert und vergeudet.
Langsam näherte sich Goldmund seinem Ziel, und in dieser letzten Zeit befiel ihn mehrmals die Furcht, er möchte vorher noch die Pest erwischen und in irgendeinem Stalle sterben müssen. Er wollte jetzt nicht mehr sterben, nicht, ehe er das Glück genossen hätte, noch einmal in einer Werkstatt zu stehen und sich dem Schaffen hinzugeben. Zum erstenmal in seinem Leben war ihm jetzt die Welt zu weit und das deutsche Reich zu groß. Kein hübsches Städtchen konnte ihn zur Rast verlocken, keine hübsche Bauernmagd hielt ihn länger fest als eine Nacht.
Einmal kam er an einer Kirche vorüber, an deren Portal standen in tiefen, von Schmucksäulchen getragenen Nischen viele Steinfiguren aus sehr alter Zeit, Figuren von Engeln, Aposteln und Märtyrern, wie er ähnliche schon oft gesehen hatte; auch in seinem Kloster, in Mariabronn, hatte es manche Figuren dieser Art gegeben. Früher, als Jüngling, hatte er sie gerne, aber ohne Leidenschaft betrachtet; sie schienen ihm schön und würdevoll, aber ein wenig zu feierlich und etwas steif und altvaterisch. Später dann, nachdem er am Ende seiner ersten großen Wanderschaft von jener süßen traurigen Mutter Gottes des Meisters Niklaus so sehr ergriffen und entzückt worden war, hatte er diese altfränkisch feierlichen Steinfiguren allzu schwer und starr und fremd gefunden, er hatte sie mit einem gewissen Hochmut betrachtet und hatte in der neuen Art seines Meisters eine viel lebendigere, innigere, beseeltere Kunst gesehen. Heute nun, da er voll von Bildern, die Seele gezeichnet von den Narben und Spuren heftiger Abenteuer und Erlebnisse, voll schmerzlicher Sehnsucht nach Besinnung und nach neuem Schaffen aus der Welt zurückkam, rührten diese uralten strengen Figuren sein Herz plötzlich mit übermächtiger Gewalt. Andächtig stand er vor den ehrwürdigen Bildern, in welchen das Herz einer lang vergangenen Zeit fortlebte und die Ängste und Entzückungen längst verschwundener Geschlechter nach Jahrhunderten noch zu Stein erstarrt der Vergänglichkeit Trotz boten. In seinem verwilderten Herzen erhob sich schauernd und demütig das Gefühl der Ehrfurcht und ein Grauen vor seinem vergeudeten und verbrannten Leben. Er tat, was er unendlich lange nicht mehr getan hatte, er suchte einen Beichtstuhl auf, um zu bekennen und sich strafen zu lassen.
Aber wohl gab es Beichtstühle in der Kirche, doch in keinem einen Priester; sie waren gestorben, lagen im Hospital, waren geflohen, fürchteten Ansteckung. Die Kirche war leer, hohl klangen Goldmunds Schritte im Steingewölbe wider. Er kniete vor einem der leeren Beichtstühle nieder, schloß die Augen und flüsterte ins Sprechgitter hinein: »Lieber Gott, sieh, was aus mir geworden ist. Ich komme aus der Welt zurück und bin ein schlechter unnützer Mensch geworden, ich habe meine jungen Jahre vertan wie ein Verschwender, wenig ist übriggeblieben. Ich habe getötet, ich habe gestohlen, ich habe gehurt, ich bin müßig gegangen und habe andern das Brot weggegessen. Lieber Gott, warum hast du uns so geschaffen, warum führst du uns solche Wege? Sind wir nicht deine Kinder? Ist nicht dein Sohn für uns gestorben? Gibt es nicht Heilige und Engel, uns zu leiten? Oder sind das alles hübsche erfundene Geschichten, die man den Kindern erzählt und über die die Pfaffen selber lachen? Ich bin irr an dir geworden, Gottvater, du hast die Welt übel geschaffen, schlecht hältst du sie in Ordnung. Ich habe Häuser und Gassen voll von Toten liegen sehen, ich habe gesehen, wie die Reichen sich in ihren Häusern verschanzt haben oder geflohen sind und wie die Armen ihre Brüder unbegraben haben liegenlassen, wie sie einer den andern verdächtigt und die Juden wie Vieh totgeschlagen haben. Ich habe so viele Unschuldige leiden und untergehen sehen und so viele Böse im Wohlleben schwimmen. Hast du uns denn ganz vergessen und verlassen, ist dir deine Schöpfung ganz entleidet, willst du uns alle zugrunde gehen lassen?«
Seufzend trat er durchs hohe Portal heraus und sah die schweigenden Steinbilder, Engel und Heilige, hager und hoch in ihren starr gefalteten Gewändern stehen, unbewegt, unerreichbar, übermenschlich und doch von Menschenhand und aus Menschengeist geschaffen. Streng und taub standen sie da oben auf ihrem knappen Räume, keiner Bitte und Frage zugänglich, und waren doch ein unendlicher Trost, waren ein triumphierender Sieg über Tod und Verzweiflung, wie sie in ihrer Würde und Schönheit standen und ein hinsterbendes Menschengeschlecht ums andere überdauerten. Ach, daß hier auch die arme schöne Jüdin Rebekka stünde und die arme, mit der Hütte verbrannte Lene und die holde Lydia und Meister Niklaus! Aber sie würden einmal stehen und dauern, er würde sie hinstellen, und ihre Gestalten, die ihm heute Liebe und Qual, Angst und Leidenschaft bedeuteten, würden vor den später Lebenden stehen, ohne Namen und Geschichte, stille, schweigende Sinnbilder des Menschenlebens.