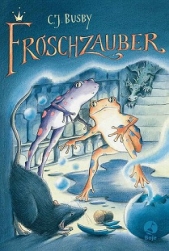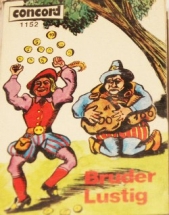Peter Camenzind

Peter Camenzind читать книгу онлайн
»Im Anfang war der Mythus. Wie der gro?e Gott in den Seelen der Inder, Griechen und Germanen dichtete und nach Ausdruck rang, so dichtet er in jedes Kindes Seele t?glich wieder.« Mit diesen S?tzen beginnt die erste Erz?hlung Hermann Hesses (1877-1962), die 1904 im S. Fischer Verlag erschien und ihren Autor mit einem Schlag ber?hmt machte. Der in unmittelbarer Nachfolge von Gottfried Kellers Gr?nem Heinrich stehende »Erziehungsroman« hat mit seinen erfrischenden, allem Pathetischen abholden Naturschilderungen bis heute nichts an Charme und Farbe verloren. Hesse selbst hat den dezidierten Individualismus Camenzinds als den »Anfang des roten Fadens« bezeichnet, der sein ganzes Werk durchzieht.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Noch stärker und lebendiger war eine andere Sehnsucht in mir. Ich wollte gern einen Freund haben.
Da war ein braunhaariger, ernsthafter Knabe, zwei Jahre älter als ich, namens Kaspar Hauri. Er hatte eine sichere und stille Art zu gehen und dazusein, trug den Kopf männlich fest und ernst und sprach nicht viel mit seinen Kameraden. An ihm blickte ich monatelang mit großer Verehrung empor, hielt mich auf der Straße hinter ihm her und hoffte sehnlich von ihm bemerkt zu werden. Ich war auf jeden Spießbürger eifersüchtig, den er grüßte, und auf jedes Haus, in das ich ihn eintreten oder aus dem ich ihn kommen sah. Aber ich war zwei Klassen hinter ihm zurück, und er fühlte sich vermutlich der seinigen schon überlegen. Es ist nie ein Wort zwischen uns gewechselt worden. Statt seiner schloß sich ohne mein Zutun ein kleiner kränklicher Knabe an mich an. Er war jünger als ich, schüchtern und unbegabt, hatte aber schöne, leidende Augen und Gesichtszüge. Weil er schwächlich und ein wenig verwachsen war, stand er in seiner Klasse viel Unbilden aus und suchte an mir, der ich stark und angesehen war, einen Beschützer. Bald ward er so krank, daß er die Schule nicht mehr besuchen konnte. Er fehlte mir nicht, und ich vergaß ihn rasch.
Nun war in unserer Klasse ein ausgelassener Blondkopf, ein Tausendkünstler, Musiker, Mime und Hanswurst. Ich gewann seine Freundschaft nicht ohne Mühe, und der flotte kleine Altersgenosse benahm sich stets ein klein wenig gönnerhaft gegen mich. Immerhin hatte ich nun einen Freund. Ich suchte ihn in seinem Stüblein auf, las ein paar Bücher mit ihm, machte ihm die griechischen Aufgaben und ließ mir dafür im Rechnen helfen. Auch gingen wir manchmal miteinander spazieren und müssen dann wie Bär und Wiesel ausgesehen haben. Er war immer der Sprecher, der Lustige, Witzige, nie Verlegene, und ich hörte zu, lachte und war froh, einen so burschikosen Freund zu haben.
Eines Nachmittags aber kam ich unversehens dazu, wie der kleine Charlatan im Schulhausgang einigen Kameraden eine von seinen beliebten komischen Aufführungen zum besten gab. Soeben hatte er einen Lehrer nachgemacht, nun rief er: »Ratet, wer das ist!« und begann laut ein paar Homerverse zu lesen. Dabei kopierte er mich sehr getreu, meine verlegene Haltung, mein ängstliches Lesen, meine oberländisch rauhe Aussprache und auch meine ständige Gebärde der Aufmerksamkeit, das Blinzeln und das Schließen des linken Auges. Es sah sich sehr komisch an und war so witzig und lieblos als möglich gemacht.
Als er das Buch schloß und den verdienten Beifall einstrich, trat ich von hinten an ihn her und nahm Rache. Worte fand ich nicht, aber ich brachte meine ganze Entrüstung, Scham und Wut in einer einzigen, riesigen Ohrfeige prägnant zum Ausdruck. Gleich darauf begann die Lektion, und der Lehrer bemerkte das Wimmern und die rotgeschwollene Backe meines ehemaligen Freundes, welcher obendrein sein Liebling war. »Wer hat dich so zugerichtet?«
»Der Camenzind.«
»Camenzind vortreten! Ist das wahr?«
»Jawohl.«
»Warum hast du ihn geschlagen?«
Keine Antwort.
»Hast du keinen Grund dazu gehabt?«
»Nein.«
Also wurde ich energisch bestraft und schwelgte stoisch in der Wonne des unschuldig Gemarterten. Da ich aber kein Stoiker noch Heiliger, sondern ein Schulbub war, streckte ich nach erlittener Strafe meinem Feind die Zunge heraus, so lang sie war. Entsetzt fuhr der Lehrer auf mich los.
»Schämst du dich nicht? Was soll das heißen?«
»Das soll heißen, daß der dort ein gemeiner Kerl ist und daß ich ihn verachte. Und ein Feigling ist er auch noch.«
So endete meine Freundschaft mit dem Mimen. Er fand keinen Nachfolger, und ich habe die Jahre der reifenden Knabenzeit ohne Freund verbringen müssen. Aber ob auch meine Anschauung des Lebens und der Menschen seither sich einigemal verändert hat, jener Ohrfeige erinnere ich mich nie ohne tiefe Befriedigung. Hoffentlich hat auch der Blonde sie nicht vergessen.
Mit siebzehn Jahren verliebte ich mich in eine Advokatentochter. Sie war schön, und ich bin stolz darauf, daß ich mein Leben lang immer nur in sehr schöne Frauenbilder verliebt war. Was ich um sie und um andere litt, erzähle ich ein andermal. Sie hieß Rösi Girtanner und ist heute noch der Liebe ganz anderer Männer, als ich bin, würdig.
Damals brauste mir die ungebrauchte Jugendkraft in allen Gliedern. Ich ließ mich mit meinen Kameraden in tolle Raufhändel ein, fühlte mich stolz als bester Ringer, Ballschläger, Wettläufer und Ruderer und war nebenher beständig schwermütig. Das hing kaum mit der Liebesgeschichte zusammen. Es war einfach die süße Schwermut des Vorfrühlings, die mich stärker als andere anfaßte, so daß ich Freude an traurigen Vorstellungen, an Todesgedanken und an pessimistischen Ideen hatte. Natürlich fand sich auch der Kamerad, der mir Heines »Buch der Lieder« in einer billigen Ausgabe zu lesen gab. Es war eigentlich kein Lesen mehr – ich goß in die leeren Verse mein volles Herz, ich litt mit, dichtete mit und geriet in ein lyrisches Schwärmen hinein, das mir vermutlich zu Gesichte stand wie dem Ferkel die Chemisette. Bis dahin hatte ich von aller »schönen Literatur« keine Ahnung gehabt. Nun folgte Lenau, Schiller, dann Goethe und Shakespeare, und plötzlich war mir der blasse Schemen Literatur zu einer großen Gottheit geworden.
Mit süßem Schauder fühlte ich aus diesen Büchern mir die würzig kühle Luft eines Lebens entgegenströmen, das nie auf Erden gewesen und doch wahrhaftig war und nun in meinem ergriffenen Herzen seine Wellen schlagen und seine Schicksale erleben wollte. In meinem Lesewinkel auf der Dachbodenkammer, wohin nur das Stundenschlagen vom nahen Turmgestühl und das trockene Klappern der daneben nistenden Störche drang, gingen die Menschen Goethes und Shakespeares bei mir ein und aus. Das Göttliche und Lächerliche alles Menschenwesens ging mir auf: das Rätsel unseres zwiespältigen, unbändigen Herzens, die tiefe Wesenheit der Weltgeschichte und das mächtige Wunder des Geistes, der unsre kurzen Tage verklärt und durch die Kraft des Erkennens unser kleines Dasein in den Kreis des Notwendigen und Ewigen erhebt. Wenn ich den Kopf durch die schmale Fensterluke steckte, sah ich die Sonne auf Dächer und schmale Gassen scheinen, hörte verwundert die kleinen Geräusche der Arbeit und Alltäglichkeit verworren herauf rauschen und fühlte das Einsame und Geheimnisvolle meines von großen Geistern erfüllten Dachwinkels wie ein sonderbar schönes Märchen mich umgeben. Und allmählich, je mehr ich las und je wunderlicher und fremder mich das Hinunterblicken auf Dächer, Gassen und Alltag ergriff, tauchte des öfteren zaghaft und beklemmend das Gefühl in mir auf, auch ich sei vielleicht ein Seher und die vor mir ausgebreitete Welt warte auf mich, daß ich einen Teil ihrer Schätze höbe, den Schleier des Zufälligen und Gemeinen davon löse und das Entdeckte durch Dichterkraft dem Untergang entreiße und verewige.
Schamhaft fing ich an, ein wenig zu dichten, und es füllten sich allmählich einige Hefte mit Versen, Entwürfen und kleinen Erzählungen an. Sie sind untergegangen und waren vermutlich wenig wert, bereiteten mir aber Herzklopfen und heimliche Wonne genug. Nur langsam folgte diesen Versuchen Kritik und Selbstprüfung nach, und erst im letzten Schuljahr trat die notwendige erste, große Enttäuschung ein. Ich hatte schon begonnen, mit meinen Erstlingsgedichten aufzuräumen und meine Schreiberei überhaupt mit Mißtrauen zu betrachten, als mir durch Zufall ein paar Bände Gottfried Keller in die Hände fielen, die ich sogleich zweimal und dreimal hintereinander las. Da sah ich in plötzlicher Erkenntnis, wie fern meine unreifen Träumereien der echten, herben, wahrhaftigen Kunst gewesen waren, verbrannte meine Gedichte und Novellen und blickte nüchtern und traurig mit peinlichen Katzenjammergefühlen in die Welt.