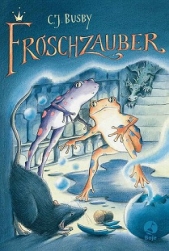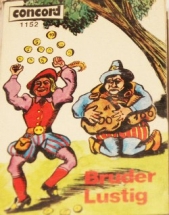Narzi? und Goldmund

Narzi? und Goldmund читать книгу онлайн
Hermann Hesses Erz?hlung ?ber den Gegensatz zwischen Geist- und Sinnenmenschen und ihre produktive Vereinigung im K?nstler ist eine moderne Gestaltung des Don-Juanund Casanova-Motivs. Sie ist aber auch ein Loblied der Freundschaft, voller Abenteuer in einem zeitlosen Mittelalter. Kl?sterlicher und st?dtischer Kunstbetrieb, Zigeunerm?dchen und Vagantenpoesie: »Alle diese Elemente deutsch-romantischer Erz?hlkunst vereinen sich hier in seltener Vollst?ndigkeit« (Rolf Schneider). Jahre bevor der Nationalsozialismus die kulturellen Traditionen Deutschlands mi?brauchte, hat Hesse in diesem Roman die Idee von Deutschland und deutschem Wesen, die er seit seiner Kindheit in sich trug, dargestellt und ihr seine »Liebe gestanden, gerade weil ich alles, was heute spezifisch deutsch ist, so sehr hasse«, schrieb er 1933. Zu Hesses Lebzeiten war Narzi? und Goldmund das erfolgreichste seiner B?cher. Die deutsche Gesamtauflage von 1930 bis heute betr?gt mehr als zwei Millionen Exemplare. ?bersetzt ist der Roman mittlerweile in drei?ig Sprachen.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Im Laufe eines Jahres hatte Goldmund viel gelernt. Im Zeichnen war er schnell zu großer Sicherheit gekommen, und neben dem Holzschnitzen ließ ihn Niklaus gelegentlich auch das Modellieren in Ton versuchen. Sein erstes gelungenes Werk war eine Tonfigur, gut zwei Spannen hoch, es war die süße verführerische Gestalt der kleinen Julie, der Schwester Lydias. Der Meister lobte diese Arbeit, aber Goldmunds Wunsch, sie in Metall gießen zu lassen, erfüllte er nicht; ihm war die Figur zu unkeusch und weltlich, als daß er ihr hätte als Pate dienen mögen. Dann kam die Arbeit an der Figur des Narziß, Goldmund führte sie in Holz aus, und zwar als Jünger Johannes; denn Niklaus wollte sie, wenn sie gelänge, in eine Kreuzigungsgruppe stellen, die er in Auftrag hatte und an der die beiden Gehilfen seit langer Zeit ausschließlich arbeiteten, um die letzte Ausführung dann dem Meister zu überlassen.
An der Narzißfigur arbeitete Goldmund mit tiefer Liebe, in dieser Arbeit fand er sich selbst, seine Künstlerschaft und seine Seele wieder, sooft er aus dem Geleise gekommen war, und das geschah nicht selten: Liebschaften, Tanzfeste, Zechereien mit Kameraden, Würfelspiel und häufig auch Raufhändel rissen ihn heftig mit, daß er für einen oder mehrere Tage die Werkstatt mied oder verstört und verdrossen bei der Arbeit stand. An seinem Jünger Johannes aber, dessen geliebte sinnende Gestalt ihm immer reiner aus dem Holz entgegentrat, arbeitete er nur in den Stunden der Bereitschaft, mit Hingabe und Demut. In diesen Stunden war er weder froh noch traurig, wußte weder von Lebenslust noch von Vergänglichkeit; es kehrte ihm jenes ehrfürchtige, lichte und rein gestimmte Gefühl im Herzen wieder, mit dem er einst dem Freunde hingegeben und seiner Führung froh gewesen war. Nicht er war es, der da stand und aus eigenem Willen ein Bildnis schuf; vielmehr war es der andere, es war Narziß, der sich seiner Künstlerhände bediente, um aus der Vergänglichkeit und Veränderlichkeit des Lebens herauszutreten und das reine Bild seines Wesens darzustellen.
Auf diese Art, fühlte Goldmund manchmal mit einem Schauder, entstanden die echten Werke. So war des Meisters unvergeßliche Madonna entstanden, die er seitdem an manchem Sonntag im Kloster wieder aufgesucht hatte. So, auf diese geheimnisvolle und heilige Art, waren die paar besten von jenen alten Figuren entstanden, die der Meister oben in der Diele stehen hatte. So würde einst auch jenes Bild entstehen, jenes andere, jenes einzige, das ihm noch geheimnisvoller und ehrwürdiger war, das Bild der Menschenmutter. Ach, daß aus Menschenhänden doch einzig solche Kunstwerke hervorgehen möchten, solche heilige, notwendige, von keinem Wollen und keiner Eitelkeit befleckte Bilder! Aber es war nicht so, er wußte es längst. Man konnte auch andere Bilder schaffen, hübsche und entzückende Sachen, mit großer Meisterschaft gemacht, die Freude der Kunstliebhaber, der Schmuck der Kirchen und Ratssäle – schöne Dinge, ja, aber nicht heilige, nicht echte Seelenbilder. Er kannte nicht nur von Niklaus und anderen Meistern manche solche Werke, die bei aller Anmut der Erfindung und aller Sorgfalt der Arbeit doch eben nur Spielereien waren. Er wußte es, zu seiner Beschämung und Trauer, auch schon im eigenen Herzen, hatte es in seinen eigenen Händen gespürt, wie ein Künstler solche hübsche Dinge in die Welt stellen kann, aus Lust am eigenen Können, aus Ehrgeiz, aus Tändelei.
Als ihm diese Erkenntnis zum ersten Male kam, wurde er todestraurig. Ach, um hübsche Engelsfigürchen oder andern Tand zu machen, und sei er noch so hübsch, lohnte es sich nicht, Künstler zu sein. Für andere vielleicht, für Handwerker, für Bürger, für stille zufriedene Seelen mochte es sich lohnen, für ihn aber nicht. Für ihn waren Kunst und Künstlerschaft wertlos, wenn sie nicht brannten wie Sonne und Gewalt hatten wie Stürme, wenn sie nur Behagen brachten, nur Angenehmes, nur kleines Glück. Er suchte anderes. Eine zierlich wie Spitzenwerk gebaute Marienkrone schön mit blankem Blattgold zu vergolden war keine Arbeit für ihn, auch wenn es gut bezahlt wurde. Warum nahm Meister Niklaus alle diese Aufträge an? Warum hielt er sich zwei Gehilfen? Warum hörte er stundenlang diese Ratsherren oder Pröpste an, wenn sie ein Portal oder eine Kanzel bei ihm bestellten, mit dem Ellenmaß in der Hand? Er tat es aus zwei Gründen, zwei schäbigen Gründen: weil er darauf hielt, ein berühmter und mit Aufträgen überhäufter Künstler zu sein, und weil er Geld anhäufen wollte, Geld nicht für große Unternehmungen oder Genüsse, sondern Geld für seine Tochter, die schon längst ein reiches Mädchen war, Geld für ihre Aussteuer, für Spitzenkragen und Brokatkleider und für ein nußbaumenes Ehebett voll kostbarer Decken und Leinenzeuge! Als ob das schöne Mädchen die Liebe nicht auf jedem Heuboden ebensogut erfahren könnte!
Tief rührte sich in den Stunden solcher Betrachtungen das Blut der Mutter in Goldmund, der Stolz und die Verachtung des Heimatlosen gegen die Seßhaften und Besitzenden. Zuweilen war ihm das Handwerk und der Meister zuwider wie fädige Bohnen, oft war er nahe am Davonlaufen.
Auch der Meister hatte es schon manches Mal ärgerlich bereut, daß er sich auf diesen schwierigen und unzuverlässigen Burschen eingelassen habe, der seine Geduld oft auf schwere Proben stellte. Was er vom Lebenswandel Goldmunds erfuhr, von seiner Gleichgültigkeit gegen Geld und Besitz, seiner Verschwendungslust, seinen vielen Liebschaften, seinen häufigen Raufereien, konnte ihn nicht milder stimmen; er hatte da einen Zigeuner, einen unvertrauten Gesellen bei sich aufgenommen. Auch war ihm nicht entgangen, mit welchen Augen dieser Vagabund seine Tochter Lisbeth betrachtete. Wenn er dennoch für ihn mehr Geduld aufbrachte, als ihm leichtfiel, so tat er es nicht aus Pflichtgefühl und Ängstlichkeit, sondern des Jüngers Johannes wegen, dessen Figur er entstehen sah. Mit einem Gefühl von Liebe und Seelenverwandtschaft, das er sich nicht ganz eingestand, sah der Meister zu, wie dieser aus den Wäldern ihm zugelaufene Zigeuner aus jener so rührenden, so schönen und doch so ungeschickten Zeichnung, deretwegen er ihn damals bei sich behalten hatte, nun langsam und launisch, aber zäh und unfehlbar seine hölzerne Jüngerfigur bildete. Sie würde, daran zweifelte der Meister nicht, trotz allen Launen und Unterbrechungen einmal fertig werden, und dann würde sie ein Werk sein, wie es keiner seiner Gesellen je machen konnte, wie es auch großen Meistern nicht viele Male glückt. So vieles dem Meister an seinem Schüler mißfiel, so manchen Tadel er ihm spendete, so oft er wütend über ihn war – über den Johannes sagte er ihm nie ein Wort. Der Rest von Jünglingsanmut und knabenhafter Kindlichkeit, wegen deren Goldmund so vielen Wohlgefallen hatte, war ihm in diesen Jahren allmählich verlorengegangen. Er war ein schöner und starker Mann geworden, sehr begehrt von den Frauen, bei den Männern wenig beliebt. Auch sein Gemüt, sein inneres Antlitz hatte sich sehr verändert, seit Narziß ihn aus dem holden Schlaf seiner Klosterjahre erweckt hatte, seit Welt und Wanderschaft ihn geknetet hatten. Aus dem hübschen, sanften, bei allen beliebten, frommen und dienstwilligen Klosterschüler war längst ein ganz anderer Mensch geworden. Narziß hatte ihn erweckt, die Frauen hatten ihn wissend gemacht, die Wanderschaft hatte den Flaum von ihm gestreift. Freunde hatte er nicht, sein Herz gehörte den Frauen. Die konnten ihn leicht gewinnen, ein verlangender Blick war schon genug. Er konnte einer Frau nicht leicht widerstehen, er gab auf die leiseste Werbung Antwort. Und er, der eine sehr zarte Empfindung für Schönheit hatte und stets am meisten die ganz jungen Mädchen im Flaum ihres Frühlings liebte, er ließ sich dennoch auch von wenig schönen und nicht mehr jungen Frauen rühren und verführen. Auf dem Tanzboden blieb er zuweilen an irgendeinem ältlichen und mutlosen Mädchen hängen, das keiner begehrte und das ihn auf dem Wege des Mitleids gewann, und nicht nur des Mitleids, sondern auch einer ewig wachen Neugierde. Sobald er sich einem Weibe hinzugeben begann – mochte das nun Wochen oder bloß Stunden dauern –, dann war sie schön für ihn, dann gab er sich ganz. Und die Erfahrung lehrte ihn, daß jede Frau schön sei und zu beglücken vermöge, daß die Unscheinbare und von den Männern Mißachtete einer unerhörten Glut und Hingabe, die Verblühte einer mehr als mütterlichen, trauernd süßen Zärtlichkeit fähig sei, daß jede Frau ihr Geheimnis und ihren Zauber habe, dessen Erschließung selig machte. Darin waren alle Frauen gleich. Jeder Mangel an Jugend oder Schönheit wurde durch irgendeine besondere Gebärde aufgewogen. Nur allerdings vermochte nicht jede ihn gleich lange zu fesseln. Er war gegen die Jüngste und Schönste um keinen Grad liebevoller oder dankbarer als gegen eine Unschöne, er liebte niemals halb. Aber es gab Frauen, die ihn nach drei oder nach zehn Liebesnächten erst recht an sich banden, und andere, die schon nach dem erstenmal erschöpft waren und vergessen wurden.
Die Liebe und Wollust schien ihm das einzige zu sein, wodurch das Leben wahrhaft erwärmt und mit Wert erfüllt werden könne. Unbekannt war ihm Ehrgeiz, Bischof oder Bettler galt ihm gleich; auch Erwerb und Besitz vermochte ihn nicht zu fesseln, er verachtete sie, er hätte ihnen nie das kleinste Opfer gebracht und warf das Geld, das er zu manchen Zeiten reichlich verdiente, sorglos weg. Die Liebe der Frauen, das Spiel der Geschlechter, das stand ihm obenan, und der Kern seiner häufigen Neigung zu Traurigkeit und Überdruß wuchs aus der Erfahrung von der Flüchtigkeit und Vergänglichkeit der Wollust. Das rasche, flüchtige, entzückende Auflodern der Liebeslust, ihr kurzes sehnliches Brennen, ihr rasches Erlöschen – dies schien ihm den Kern alles Erlebens zu enthalten, dies wurde ihm zum Bilde für alle Wonne und alles Leid des Lebens. Jener Trauer und jenem Vergänglichkeitsschauer konnte er sich mit ebensolcher Hingabe überlassen wie der Liebe, und auch diese Schwermut war Liebe, auch sie war Wollust. So wie die Liebeswonne im Augenblick ihrer höchsten, seligsten Spannung sicher ist, mit dem nächsten Atemzug hinschwinden und wiederum sterben zu müssen, so war auch die innigste Einsamkeit und Hingabe an die Schwermut sicher, plötzlich verschlungen zu werden vom Verlangen, von neuer Hingabe an die lichte Seite des Lebens. Tod und Wollust waren eines. Die Mutter des Lebens konnte man Liebe oder Lust nennen, man konnte sie auch Grab und Verwesung nennen. Die Mutter war Eva, sie war die Quelle des Glücks und die Quelle des Todes, sie gebar ewig, tötete ewig, in ihr waren Liebe und Grausamkeit eins, und ihre Gestalt wurde ihm zum Gleichnis und heiligen Sinnbild, je länger er sie in sich trug.
Er wußte, nicht mit Worten und Bewußtsein, aber mit dem tieferen Wissen des Blutes, daß sein Weg zur Mutter führe, zur Wollust und zum Tode. Die väterliche Seite des Lebens, der Geist, der Wille, war nicht seine Heimat. Dort war Narziß zu Hause, und jetzt erst durchdrang und verstand Goldmund seines Freundes Worte ganz und sah in ihm sein Gegenspiel, und dies bildete er auch in seiner Johannesfigur und machte es sichtbar. Man konnte sich nach Narziß bis zu Tränen sehnen, man konnte wunderbar von ihm träumen – ihn erreichen, werden wie er aber konnte man nicht.