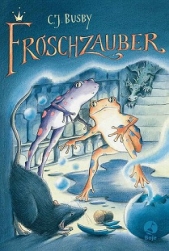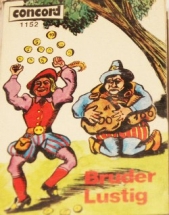Der Wanderer und sein Schatten

Der Wanderer und sein Schatten читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Die Ungeduldigen. — Gerade der Werdende will das Werdende nicht: er ist zu ungeduldig dafür. Der Jüngling will nicht warten, bis, nach langen Studien, Leiden und Entbehrungen, sein Gemälde von Menschen und Dingen voll werde: so nimmt er ein anderes, das fertig dasteht und ihm angeboten wird, auf Treu und Glauben an, als müsse es ihm die Linien und Farben seines Gemäldes vorweg geben, er wirft sich einem Philosophen, einem Dichter ans Herz und muß nun eine lange Zeit Frondienste tun und sich selber verleugnen. Vieles lernt er dabei: aber häufig vergißt ein Jüngling das Lernens- und Erkenntniswerteste darüber — sich selber; er bleibt zeitlebens ein Parteigänger. Ach, es ist viel Langeweile zu überwinden, viel Schweiß nötig, bis man seine Farben, seinen Pinsel, seine Leinwand gefunden hat! — Und dann ist man noch lange nicht Meister seiner Lebenskunst — aber wenigstens Herr in der eigenen Werkstatt.
Es gibt keine Erzieher. — Nur von Selbst-Erziehung solle man als Denker reden. Die Jugend-Erziehung durch andere ist entweder ein Experiment, an einem noch Unerkannten, Unerkennbaren vollzogen, oder eine grundsätzliche Nivellierung, um das neue Wesen, welches es auch sei, den Gewohnheiten und Sitten, welche herrschen, gemäß zu machen : in beiden Fällen also etwas, das des Denkers unwürdig ist, das Werk der Eltern und Lehrer, welche einer der verwegenen Ehrlichen nos ennemis naturels genannt hat. — Eines Tages, wenn man längst, nach der Meinung der Welt, erzogen ist, ent- deckt man sich selber : da beginnt die Aufgabe des Denkers; jetzt ist es Zeit, ihn zu Hilfe zu rufen — nicht als einen Erzieher, sondern als einen Selbst-Erzogenen, der Erfahrung hat.
Mitleiden mit der Jugend. — Es jammert uns, wenn wir hören, daß einem Jünglinge schon die Zähne ausbrechen, einem andern die Augen erblinden. Wüßten wir alles Unwiderrufliche und Hoffnungslose, das in seinem ganzen Wesen steckt, wie groß würde erst der Jammer sein! — Weshalb leiden wir hierbei eigentlich? Weil die Jugend fortführen soll, was wir unternommen haben, und jeder Ab- und Anbruch ihrer Kraft unserem Werke, das in ihre Hände fällt, zum Schaden gereichen will. Es ist der Jammer über die schlechte Garantie unserer Unsterblichkeit: oder wenn wir uns nur als Vollstrecker der Menschheits-Mission fühlen, der Jammer darüber, daß diese Mission in schwächere Hände, als die unsrigen sind, übergehen muß.
Die Lebensalter. — Die Vergleichung der vier Jahreszeiten mit den vier Lebensaltern ist eine ehrwürdige Albernheit. Weder die ersten 20, noch die letzten 20 Jahre des Lebens entsprechen einer Jahreszeit: vorausgesetzt, daß man sich bei der Vergleichung nicht mit dem Weiß des Haares und Schnees und mit ähnlichen Farbenspielen begnügt. Jene ersten zwanzig Jahre sind eine Vorbereitung auf das Leben überhaupt, auf das ganze Lebensjahr, als eine Art langen Neujahrstages; und die letzten zwanzig überschauen, verinnerlichen, bringen in Fug und Zusammenklang, was nur alles vorher erlebt wurde: so wie man es, in kleinem Maße, an jedem Silvestertage mit dem ganzen verflossenen Jahre tut. Zwischen inne liegt aber in der Tat ein Zeitraum, welcher die Vergleichung mit den Jahreszeiten nahelegt der Zeitraum vom zwanzigsten bis zum fünfzigsten Jahre (um hier einmal in Bausch und Bogen nach Jahrzehnten zu rechnen, während es sich von selber versteht, daß jeder nach seiner Erfahrung diese groben Ansätze für sich verfeinern muß). Jene dreimal zehn Jahre entsprechen dreien Jahreszeiten: dem Sommer, dem Frühling und dem Herbste, — einen Winter hat das menschliche Leben nicht, es sei denn, daß man die leider nicht selten eingeflochtenen harten, kalten, einsamen, hoffnungsarmen, unfruchtbaren Krankheitszeiten die Winterzeiten der Menschen nennen will. Die zwanziger Jahre: heiß, lästig, gewitterhaft, üppig treibend, müde machend, Jahre, in denen man den Tag am Abend, wenn er zu Ende ist, preist und sich dabei die Stirn abwischt: Jahre, in denen die Arbeit uns hart, aber notwendig dünkt, — diese zwanziger Jahre sind der Sommer des Lebens. Die dreißiger dagegen sind sein Frühling : die Luft bald zu warm, bald zu kalt, immer unruhig und anreizend: quellender Saft, Blätterfülle, Blütenduft überall: viele bezaubernde Morgen und Nächte: die Arbeit, zu der der Vogelgesang uns weckt, eine rechte Herzens-Arbeit, eine Art Genuß der eigenen Rüstigkeit, verstärkt durch vorgenießende Hoffnungen. Endlich die vierziger Jahre: geheimnisvoll, wie alles Stillestehende; einer hohen weiten Berg-Ebene gleichend, an der ein frischer Wind hinläuft; mit einem klaren, wolkenlosen Himmel darüber, welcher den Tag über und in die Nächte hinein immer mit der gleichen Sanftmut blickt: die Zeit der Ernte und der herzlichsten Heiterkeit — es ist der Herbst des Lebens.
Der Geist der Frauen in der jetzigen Gesellschaft. — Wie die Frauen jetzt über den Geist der Männer denken, errät man daraus, daß sie bei ihrer Kunst des Schmückens an alles eher denken, als den Geist ihrer Züge oder die geistreichen Einzelheiten ihres Gesichts noch besonders zu unterstreichen: sie verbergen Derartiges vielmehr und wissen sich dagegen, zum Beispiel durch eine Anordnung des Haars über der Stirn, den Ausdruck einer lebendig begehrenden Sinnlichkeit und Ungeistigkeit zu geben, gerade wenn sie diese Eigenschaften nur wenig besitzen. Ihre Überzeugung, daß der Geist bei Weibern die Männer erschrecke, geht so weit, daß sie selbst die Schärfe des geistigsten Sinnes gern verleugnen und den Ruf der Kurzsichtigkeit absichtlich auf sich laden; dadurch glauben sie wohl die Männer zutraulicher zu machen: es ist, als ob sich eine einladende sanfte Dämmerung um sie verbreite.
Groß und vergänglich. — Was den Betrachtenden zu Tränen rührt, das ist der schwärmerische Glückes- Blick, mit dem eine schöne junge Frau ihren Gatten ansieht. Man empfindet alle Herbst-Wehmut dabei, über die Größe sowohl, als über die Vergänglichkeit des menschlichen Glückes.
Opfer-Sinn. — Manche Frau hat den intelletto del sacrifizio und wird ihres Lebens nicht mehr froh, wenn der Gatte sie nicht opfern will: sie weiß dann mit ihrem Verstande nicht mehr wohin? und wird unversehens aus dem Opfertier der Opferpriester selber.
Das Unweibliche. — »Dumm wie ein Mann «sagen die Frauen:»feige wie ein Weib «sagen die Männer. Die Dummheit ist am Weibe das Unweibliche .
Männliches und weibliches Temperament und die Sterblichkeit. — Daß das männliche Geschlecht ein schlechteres Temperament hat, als das weibliche, ergibt sich auch daraus, daß die männlichen Kinder der Sterblichkeit mehr ausgesetzt sind, als die weiblichen, offenbar weil sie leichter» aus der Haut fahren«: ihre Wildheit und Unverträglichkeit verschlimmert alle Übel leicht bis ins Tödliche.
Die Zeit der Zyklopen-Bauten. — Die Demokratisierung Europas ist unaufhaltsam: wer sich dagegen stemmt, gebraucht doch eben die Mittel dazu, welche erst der demokratische Gedanke jedermann in die Hand gab, und macht diese Mittel selber handlicher und wirksamer: und die grundsätzlichsten Gegner der Demokratie (ich meine die Umsturzgeister) scheinen nur deshalb da zu sein, um durch die Angst, welche sie erregen, die verschiedenen Parteien immer schneller auf der demokratischen Bahn vorwärts zu treiben. Nun kann es einem angesichts derer, welche jetzt bewußt und ehrlich für diese Zukunft arbeiten, in der Tat bange werden: es liegt etwas Ödes und Einförmiges in ihren Gesichtern, und der graue Staub scheint auch bis in ihre Gehirne hinein geweht zu sein. Trotzdem: es ist möglich, daß die Nachwelt über dieses unser Bangen einmal lacht und an die demokratische Arbeit einer Reihe von Geschlechtern etwa so denkt, wie wir an den Bau von Steindämmen und Schutzmauern — als an eine Tätigkeit, die notwendig viel Staub auf Kleider und Gesichter breitet und unvermeidlich wohl auch die Arbeiter ein wenig blödsinnig macht; aber wer würde deswegen solches Tun ungetan wünschen! Es scheint, daß die Demokratisierung Europas ein Glied in der Kette jener ungeheuren prophylak- tischen Maßregeln ist, welche der Gedanke der neuen Zeit sind und mit denen wir uns gegen das Mittelalter abheben. Jetzt erst ist das Zeitalter der Zyklopenbauten! Endliche Sicherheit der Fundamente, damit alle Zukunft auf ihnen ohne Gefahr bauen kann! Unmöglichkeit fürderhin, daß die Fruchtfelder der Kultur wieder über Nacht von wilden und sinnlosen Bergwässern zerstört werden! Steindämme und Schutzmauern gegen Barbaren, gegen Seuchen, gegen leibliche und geistige Verknechtung ! Und dies alles zunächst wörtlich und gröblich, aber allmählich immer höher und geistiger verstanden, so daß alle hier angedeuteten Maßregeln die geistreiche Gesamtvorbereitung des höchsten Künstlers der Gartenkunst zu sein scheinen, der sich dann erst zu seiner eigentlichen Aufgabe wenden kann, wenn jene vollkommen ausgeführt ist! — Freilich: bei den weiten Zeitstrecken, welche hier zwischen Mittel und Zweck liegen, bei der großen, übergroßen, Kraft und Geist von Jahrhunderten anspannenden Mühsal, die schon not tut, um nur jedes einzelne Mittel zu schaffen oder herbeizuschaffen, darf man es den Arbeitern an der Gegenwart nicht zu hart anrechnen, wenn sie laut dekretieren, die Mauer und das Spalier sei schon der Zweck und das letzte Ziel; da ja noch niemand den Gärtner und die Fruchtpflanzen sieht, um derentwillen das Spalier da ist.
Das Recht des allgemeinen Stimmrechts. — Das Volk hat sich das allgemeine Stimmrecht nicht gegeben, es hat dasselbe, überall, wo es jetzt in Geltung ist, empfangen und vorläufig angenommen: jedenfalls hat es aber das Recht, es wieder zurückzugeben, wenn es seinen Hoffnungen nicht genug tut. Dies scheint jetzt allerorten der Fall zu sein: denn wenn bei irgend einer Gelegenheit, wo es gebraucht wird, kaum Zweidrittel, ja vielleicht nicht einmal die Majorität aller Stimmberechtigten an die Stimm-Urne kommt, so ist dies ein Votum gegen das ganze Stimmsystem überhaupt. — Man muß hier sogar noch viel strenger urteilen. Ein Gesetz, welches bestimmt, daß die Majorität über das Wohl aller die letzte Entscheidung habe, kann nicht auf derselben Grundlage, welche durch dasselbe erst gegeben wird, aufgebaut werden; es bedarf notwendig einer noch breiteren: und dies ist die Einstimmigkeit aller . Das allgemeine Stimmrecht darf nicht nur der Ausdruck eines Majoritäten-Willens sein: das ganze Land muß es wollen. Deshalb genügt schon der Widerspruch einer sehr kleinen Minorität, dasselbe als untunlich wieder beiseite zu stellen: und die Nichtbeteiligung an einer Abstimmung ist eben ein solcher Widerspruch, der das ganze Stimmsystem zum Falle bringt. Das» absolute Veto «des einzelnen oder, um nicht ins Kleinliche zu verfallen, das Veto weniger Tausende hängt über diesem System, als die Konsequenz der Gerechtigkeit: bei jedem Gebrauche, den man von ihm macht, muß es, laut der Art von Beteiligung, erst beweisen, daß es noch zu Recht besteht.