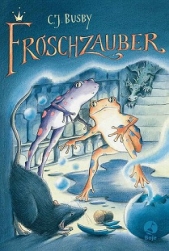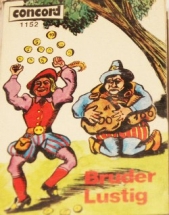Majestic – Die Saat des Todes

Majestic – Die Saat des Todes читать книгу онлайн
Eine fremdartige Macht droht die Menschheit zu vernichten.
November 1963. Die Ermordung Kennedys ersch?ttert die Welt. Doch die Menschheit ahnt nicht, wie nah sie am Abgrund steht: Eine au?erirdische Macht hat sich der wichtigsten Entscheidungstr?ger in Washington bem?chtig und will die Weltherrschaft erringen. Der junge Regierungsmitarbeiter John Loengard wei? von der Gefahr, aber als er das ganze Ausma? der Verschw?rung begreift, ist es fast zu sp?t. Zusammen mit seiner Geliebten Kimberley mobilisiert er in letzter Sekunde Kr?fte, die denen seiner Gegner ebenb?rtig scheinen. Bis er auch in den Augen eines vertrauten Menschen die Saat des Todes entdeckt...
Das Buch
1947 in einer W?stengegend im Westen der USA: Alles, was in Regierung und Milit?r Rang und Namen hat, ist unter dem n?chtlichen Himmel versammelt – Truman, der junge George Bush und die Gener?le der US-Armee. Pl?tzlich landet ein Raumschiff von einem fremden Planeten, eine T?r ?ffnet sich, und die Menschheit hat zum ersten Mal Kontakt zu Au?erirdischen.
1963: Der Agent John Loengard und seine Freundin Kim wissen, dass die Aliens sich bereits Washingtons wichtigster Entscheidungstr?ger bem?chtigt haben. Die Wesen aus dem Weltraum wollen die Welt ins Chaos st?rzen und die Weltherrschaft ?bernehmen. John und Kim hatten einen Gespr?chstermin bei Pr?sident John F. Kennedy, um ihn vor der Verschw?rung zu warnen, doch dieser wurde kurz vor dem Treffen in Dallas ermordet. Sollte verhindert werden, dass er die Wahrheit ?ber die Au?erirdischen erf?hrt? Nur John und Kim k?nnen die Menschheit vor einer grausamen ?bernahme bewahren, doch sie wissen nicht, wem sie trauen k?nnen. Vielleicht sind alle, die ihnen Hilfe anbieten, bereits Agenten der Au?erirdischen?
Dieser Roman ist die Fortsetzung zu Dark Skies – Das R?tsel um Majestic 12 (01/10.860).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
»Ja?«, fragte Steel und zog in gespielter Höflichkeit die Augenbrauen nach oben. Der sichtbare Teil seines zerstörten Auges vergrößerte sich damit und etwas schien darin aufzublitzen; ich hielt es jetzt für durchaus möglich, dass es von innen leuchtete und nicht nur Licht reflektierte.
»Lass uns vorbei, Jim«, fuhr ich stockend fort. Mein Herz klopfte mir bis zum Halse und mein Mund fühlte sich vollkommen ausgedörrt an. »Tu, was du tun musst, aber lass mich und Kim dabei aus dem Spiel.«
Steels Lächeln wirkte wie eingefroren, eher wie bei einer Schaufensterpuppe als wie bei einem Menschen. »Tut mir Leid, John. So einfach ist das nicht.« Sein Gesicht blieb maskenhaft starr, aber die Schweißperlen auf seiner Stirn verrieten, dass der mit dem schleimpilzähnlichen Ding durchzogene menschliche Körper durchaus normale menschliche Reaktionen zeigen konnte. »Du kannst von mir aus verschwinden. Nicht aber Kim. Wir brauchen sie noch.«
Ich starrte ihn einen Moment lang fassungslos an. Es war offensichtlich, dass er mich nicht so einfach gehen lassen würde, selbst wenn ich auf sein Angebot eingehen würde, das er mir, aus welchem Grund auch immer, als einen perversen Köder hinwarf. Aber was mich viel mehr schockierte, obwohl ich es tief in meinem Inneren doch längst gewusst hatte, war dieses Wir brauchen sie noch.
»Komm her, Kim«, sagte Steel überraschend sanft und streckte die Hand vor. »Wir haben auf dich gewartet.«
Einen Herzschlag lang herrschte in dem Gang absolute Stille. Ich weiß nicht, was ich in diesem Moment erwartete. Ich hielt jedenfalls alles für möglich. Es war eine jener albtraumhaften Situationen, in denen alles entsetzlich schief läuft. So schief, dass man weiß, dass das Leben danach nie mehr so sein wird wie zuvor.
Kim setzte sich langsam in Bewegung. Es waren zögernde, schleppende Schritte, Schritte, die sie von mir entfernten und die sie ganz eindeutig in Steels Richtung führen würden. Es nicht wahrhaben zu wollen verscheuchte den Gedanken nicht, dass sie Steels Ruf folgen würde, hier und jetzt. Und doch weigerte ich mich einfach, die Realität als solche anzuerkennen.
»Kim!«, rief ich. Meine Stimme klang in meinen eigenen Ohren merkwürdig schal und hohl. Ich hatte das Gefühl, neben mir zu stehen, das Ganze aus den Augen eines unbeteiligten Beobachters zu sehen. Ich wollte Kim am Arm fassen und sie zu mir herumwirbeln, aber ich war wie gelähmt, paralysiert durch die unwirkliche Szene.
Steel lächelte immer noch, aber es war kein triumphierendes Lächeln, sondern das eiskalte Grinsen einer Metallpuppe, deren Züge für immer fest gegossen sind. Er hielt beide Arme leicht angewinkelt, in der grotesken Parodie einer angedeuteten Umarmung. Es kam mir nicht im Geringsten in den Sinn, dass ich in Gefahr sein könnte. Es war die Andeutung eines Irrsinns, die mich gefangen hielt, ein Irrsinn, der von Steel und Kim auf mich übergesprungen zu sein schien und dessen eisiger Hauch mich lähmte und willenlos machte.
»Schluss jetzt«, sagte Marcel hinter mir. »Hört sofort mit dem Affentheater auf. Nehmen Sie die Hände hoch, Steel, und drehen Sie sich zur Wand um.«
Steels Blick löste sich von mir, glitt an Kim vorbei und bohrte sich irgendwo hinter mir ins Halbdunkel. Ich konnte mir nur allzu gut vorstellen, wie Marcel hinter mir stand, die entsicherte Pistole wie selbstverständlich in seinen Bürokratenhänden haltend, mit einem sicheren und doch von angespannter Aufmerksamkeit gezeichneten Stand wie ein Cop, der irgendwo in Harlem an einer Razzia beteiligt war und sich nun plötzlich allein in einem Hinterhof einer zu allem entschlossenen schwarzen Jugendgang gegenübersah. Marcel mit seiner Hornbrille und dem unmöglich braven Anzug; das war das Stück Normalität, das mich aus meiner Erstarrung riss.
Ich erwischte Kim gerade noch, als sie an mir vorbei auf Steel zuging, packte sie am Arm und hielt sie fest. Sie wehrte sich nicht.
»John, Kim, zur Seite«, befahl Marcel. Wahrscheinlich hatte er Sorge, wir könnten ihm sein Schussfeld versperren.
Steel runzelte die Stirn. So, wie er da stand, mit den immer noch angewinkelten Armen, dem hellroten Blutfleck auf seinem weißen Hemd, der das Einschussloch von Albanos Kugel markierte, und dem starren, aber nicht minder entschlossenen Gesichtsausdruck, wirkte er merkwürdig unbesiegbar. Sein glasiges, fast weißes Auge wanderte zu mir zurück und ein Ausdruck des Missfallens erschien auf seinem Gesicht, als er meinen festen Griff um Kimberleys Arm bemerkte.
Kim wandte im gleichen Moment den Kopf zu mir um; ihr schönes, ebenmäßiges Gesicht verzerrte sich zu einer Grimasse des Schreckens und einen Moment fürchtete ich, dass sie versuchen würde sich loszureißen, um auf Steel zuzustürmen, genau in die Schusslinie Marcels hinein. Aber dann stabilisierten sich ihre Gesichtszüge und ihre Mundwinkel verzogen sich sogar zur Andeutung eines Lächelns.
»Es ist schon okay«, sagte sie sanft. »Lass mich einfach los, ja?«
Ich wollte etwas erwidern, aber nach einem Blick in ihr bleiches, angespanntes Gesicht ließ ich es lieber bleiben. Mir wurde plötzlich klar, dass ich einer unvermeidlichen Konfrontation nun wieder ein Stück näher gekommen war. Vielleicht war das auch gut so. Die Sache musste sich entscheiden, so oder so. Irgendwie fühlte ich bei dem Gedanken sogar eine Erleichterung, wie ich sie schon seit Tagen nicht mehr empfunden hatte; vielleicht, weil eine Entscheidung auch bedeuten würde, dass der Wahnsinn dann ein Ende hatte.
»Lass sie endlich gehen«, sagte Steel. »Du kannst sie nicht festhalten. Was passieren muss, wird passieren.«
Kim war in einem fürchterlichen Zustand. Ihre Wangen glühten, als hätte sie Fieber. Aber es war ein anderes Feuer, das in ihr brannte, ein Feuer, das ich niemand anderem gönnte als mir selbst und von dem ich mir nie hatte träumen lassen, dass ausgerechnet Steel es würde entfachen können. Aber so war es ja auch nicht; was immer in ihr vorging, es hatte wohl nichts mehr mit der Kimberley Sayers zu tun, die ich am Abend unseres ersten Rendezvous zu küssen versucht hatte und die daraufhin nur sanft den Kopf geschüttelt hatte, um zu sagen: Bitte nicht, John, lass uns Zeit. Schon damals hatte ich gewusst, dass ich sie liebte und dass ich ihr alle Zeit geben würde, die sie brauchte.
»Nein, ich werde sie nicht loslassen«, sagte ich fest.
»Das ist ungünstig«, sagte Steel kalt und in seiner Stimme schwang etwas mit, was ich nicht einordnen konnte. Es war nicht nur ein Befehlston, es war gleichzeitig viel mehr und viel weniger als das: Es war etwas wie lüsterne Begierde in seiner Stimme. »Wir werden jetzt vollenden, was wir vor viel längerer Zeit begonnen haben, als du dir überhaupt vorstellen kannst, Loengard.«
Ich hatte natürlich keine Ahnung, was er meinte, und doch lösten seine Worte in mir höchst unerfreuliche Assoziationen aus und die gleiche kalte Angst überfiel mich, die vor unvorstellbar vielen Jahren nach meinem Kinderherzen gegriffen hatte, um mir in der Dunkelheit jedes Knacken der Holzdielen als etwas unvorstellbar Monströses oder Entsetzliches vorzugaukeln. Grell leuchtende Augen, so groß wie die Schnupftabakdose meines Großvaters, in denen Bosheit und Wahnsinn funkelten, schlurfende Schritte deformierter Körper – waren meine nächtlichen Kleinkinderphantasien wirklich so weit weg von dem, was ich jetzt für die Wirklichkeit hielt?
Aber jetzt war ich kein Kind mehr und ich hielt eine tödliche, eisenspuckende Waffe in meiner Hand und was oder wer auch immer vor mir stand: Ich konnte ihn oder es besiegen, so wie sich alles besiegen ließ, was es auf unserer Welt gab. »Es wird Zeit, dass du begreifst, dass dein Spiel aus ist, Steel«, sagte ich schroff und versuchte dabei so wenig wie möglich an Kimberley zu denken, die wehrlos im Griff meiner linken Hand auf etwas zu warten schien, an das ich lieber nicht dachte. »Wir sind drei zu eins und was auch immer du vorhast: Wir werden dich abknallen, bevor du auch nur den Finger krumm machen kannst.«