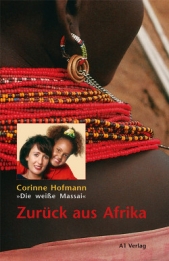Die weisse Massai
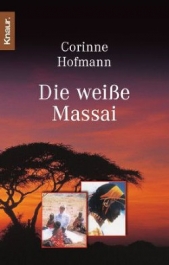
Die weisse Massai читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
In Nyahururu finden wir keine Waage. Die seien sehr teuer und daher nur in Nairobi erhältlich, erklärt uns der einzige Eisenwarenhändler. Lketinga ist nicht erfreut, aber wir brauchen die Waage unbedingt, und so fahren wir mit dem Bus in das verhaßte Nairobi. Dort werden sie überall angeboten, wobei die Preise extrem schwanken. Schließlich erstehen wir beim billigsten Anbieter für 350 Franken eine schwere Waage mit den dazugehörenden Gewichten und fahren nach Maralal zurück. Hier klappern wir alle Großhändler und Märkte ab, um die jeweils günstigsten Preise für die einzelnen Waren zu erfragen. Mein Mann findet al es zu teuer, doch ich bin überzeugt, mit geschicktem Verhandeln die gleichen Preise wie die Somalis zu bekommen. Der größte Händler bietet mir an, einen Lastwagen zu organisieren, der die Ware nach Barsaloi bringt.
Guten Mutes gehen wir am dritten Tag ins Office. Der freundliche Officer erklärt uns, es sei nur ein kleines Problem aufgetaucht. Wir müßten ein Schreiben vom Veterinär in Barsaloi bringen, daß der Shop sauber sei, und sofern wir auch das Portrait vom Staatspräsidenten vorlegen, das in jedem Geschäft hängen muß, wird er uns die Lizenz geben. Lketinga will schimpfen, doch ich halte ihn zurück. Ohnehin wil ich erst nach Hause, um den Shopvertrag schriftlich zu machen und den Laden so herzurichten, daß die Ware sinnvoll aufgebaut werden kann.
Außerdem muß eine Verkaufshilfe gefunden werden, weil ich die Sprache zu wenig beherrsche und mein Mann nicht rechnen kann.
Abends besuchen wir Sophia und ihren Freund. Sie ist aus Italien zurück, und wir haben uns viel zu erzählen. Nebenbei vertraut sie mir an, daß sie im dritten Monat schwanger ist. Über diese Nachricht freue ich mich sehr, weil ich mittlerweile glaube, in der gleichen Situation zu sein. Nur habe ich nicht die hundertprozentige Gewißheit wie sie. Im Gegensatz zu mir muß sich Sophia jeden Morgen übergeben. Über mein geschäftliches Vorhaben staunt sie sehr. Aber mit dem Wagen muß ich endlich Geld verdienen, weil ich nicht immer nur Tausende von Franken ausgeben kann.
In Barsaloi wird der Vertrag gemacht, wir sind glückliche Ladenbesitzer. Tagelang putze ich die verstaubten Gestelle und nagle den Maschendraht an den Tresen. Im hinteren Teil räume ich alte Bretter heraus. Plötzlich höre ich ein Zischen und sehe gerade noch einen grünen Schlangenkörper unter dem restlichen Holz verschwinden. Vol er Panik renne ich hinaus und schreie: „Snake, snake!“
Einige Männer schlendern herbei, doch als sie merken, um was es geht, traut sich keiner in den Raum.
Nach kurzer Zeit stehen etwa sechs Personen herum, aber keiner tut etwas, bis ein großer Turkana-Mann mit einem langen Stock kommt. Vorsichtig geht er hinein und stochert in dem Holzhaufen herum. Holz für Holz stößt er weg, bis die etwa einen Meter lange Schlange hervorschnellt. Wie wild versucht der Turkana, sie zu erschlagen, doch trotz der Schläge kriecht sie schnell durch den Ausgang auf uns zu.
Blitzschnell stößt ein Samburu-Boy seinen Speer in das gefährliche Tier. Erst als ich erfahre, wie gefährlich die Situation war, zittern meine Knie.
Mein Mann kommt etwa eine Stunde später. Er war beim Veterinär, der ihm das Schreiben gab, aber mit der Auflage, innerhalb eines Monats ein Plumpsklo außerhalb des Shops zu errichten. Auch das noch! Es melden sich ein paar Freiwil ige, vor al em Turkana-Leute, die bereit sind, das drei Meter tiefe Loch zu graben und den Rest zu erstel en. Inklusive Material kostet dies fast 600 Franken.
Das Zahlen nimmt kein Ende, und ich hoffe, daß bald Geld verdient wird.
Pater Giuliano und Roberto berichte ich von meinem Vorhaben, ein Geschäft zu eröffnen. Sie sind begeistert, weil hier das halbe Jahr kein Mais erhältlich ist. Meine Schwangerschaft erwähne ich nicht, auch in keinem Brief in die Schweiz. Obwohl ich mich sehr freue, weiß ich, wie schnel man hier krank werden kann, und ich möchte niemanden beunruhigen.
Endlich kommt unser großer Tag. Wir fahren los, um mit einem vol en Lastwagen zurückzukommen. Eine angenehme Verkaufshilfe haben wir ebenfalls gefunden, Anna, die Frau des Dorfpolizisten. Sie ist robust und hat schon in Maralal gearbeitet.
Mit gutem Wil en versteht sie sogar etwas Englisch.
In Maralal gehen wir zur Commercial Bank, um nachzufragen, ob mein bestelltes Geld aus der Schweiz eingetroffen ist. Wir haben Glück, und so hebe ich umgerechnet fast 5000 Franken ab, um die Ware einkaufen zu können. Wir bekommen bündelweise Kenia-Schillinge. Lketinga hat in seinem Leben noch nie soviel Geld gesehen. Beim Somali-Großhändler fragen wir nach, wann ein Laster für eine Fahrt nach Barsaloi zur Verfügung steht. Im Moment sind al e Flüsse ohne Wasser, und deshalb ist der Weg für die schweren Loris kein Problem, in zwei Tagen sei einer frei.
Jetzt kaufen wir ein. Der Laster kostet 300 Franken, deshalb müssen wir sein Ladegewicht von zehn Tonnen voll ausnützen. Ich bestelle 80 mal 100 kg Maismehl sowie 15 mal 100 kg Zucker, ein Vermögen für hier. Als ich gegen Quittung bezahle, nimmt Lketinga die Geldbündel wieder an sich und behauptet, ich gebe diesen Somalis viel zu viel Geld. Er möchte al es kontrol ieren. Mir ist es fast peinlich, da er diese Leute beleidigt und gar nicht so weit rechnen kann. Er bildet Häufchen um Häufchen, und kein Mensch versteht, wozu er mit dem Geld herumspielt. Mit Engelszungen rede ich auf meinen Mann ein, bis er bereit ist, mir das Geld wiederzugeben. Vor seinen Augen zähle ich noch einmal ab. Als dann 3000
Schillinge übrig sind, meint er böse: „Siehst du, das ist viel zu viel!“ Ich beruhige ihn und erkläre, dies sei die Miete für den Laster. Etwas irritiert schauen sich die drei Somalis an. Schließlich ist die Ware bestellt und wird für uns reserviert, bis der Lastwagen kommt. Nun fahre ich durch das Dorf und kaufe hier 100 kg Reis, dort 100 kg Kartoffeln und woanders Kohl und Zwiebeln.
Am späten Nachmittag ist der Laster endlich beladen. Es wird wohl elf Uhr nachts werden, bis er Barsaloi erreicht. Die zerbrechlichen Sachen wie Mineralwasser, Cola und Fanta lade ich in meinen Landrover, darüber hinaus Tomaten, Bananen, Brot, Omo, Margarine, Tee und andere Artikel. Das Auto ist voll bis unters Dach. Ich will nicht den weiten Weg nehmen, sondern durch den Wald fahren, da ich dann in zwei Stunden in Barsaloi sein kann. Lketinga fährt im Lastwagen mit, er hat berechtigte Bedenken, daß unterwegs Ware verschwindet.
Der Wildhüter und zwei Frauen fahren mit mir. Beladen wie der Wagen ist, muß ich schon bald in den Vierrad schalten, damit er die Steigung in den Wald schaffen kann.
An das Fahren mit soviel Gewicht muß ich mich erst gewöhnen, immerhin sind es etwa 700 kg. Ab und zu durchqueren wir Wasserlöcher, die hier im Dickicht selten ganz austrocknen.
Die Wiese, wo ich die Büffel sah, liegt heute verlassen da. Mit meinem Beifahrer unterhalte ich mich mühsam in Suaheli über unser Geschäft. Kurz vor dem schrägen
„Todeshang“ kommt eine steile S-Kurve. Als ich in den Hohlweg einbiege, steht eine große graue Mauer vor uns. Wie verrückt bremse ich, doch der Wagen rutscht durch das Ladegewicht langsam auf den Elefantenbullen zu. „Stop, stop the car!“
schreit der Wildhüter. Ich versuche al es, einschließlich Handbremse, die aber nicht mehr gut funktioniert. Etwa drei Meter vor dem riesigen Hinterteil bleiben wir endlich stehen. Das Tier versucht, sich langsam auf dem schmalen Weg zu drehen.
Schnel lege ich den Rückwärtsgang ein. Die Frauen kreischen im hinteren Teil des Wagens und wollen raus. Der Elefant hat sich nun gedreht und starrt uns aus seinen Knopfaugen an. Er schwingt den Rüssel in die Höhe und trompetet. Durch seine gewaltigen Stoßzähne wirkt er noch bedrohlicher. Unser Wagen schleicht langsam rückwärts, und der Abstand beträgt inzwischen sechs Meter. Der Wildhüter aber mahnt, wir seien erst außer Lebensgefahr, wenn wir uns unsichtbar machen, das heißt, hinter der Kurve verschwinden. Weil der Wagen vol gestopft ist und keinen Rückspiegel besitzt, kann ich nicht nach hinten schauen. So muß mich der Wildhüter dirigieren, und ich hoffe nur, daß ich alles richtig interpretiere.