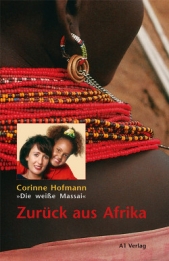Die weisse Massai
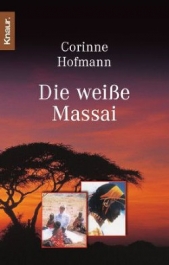
Die weisse Massai читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Allein die Angst, Lketinga könnte durchdrehen, läßt mich stärker werden. Ich wil versuchen, mich zu waschen, damit ich mich besser fühle. Mein Darling bringt mich zur Dusche, und ich schaffe es mit Müh und Not, mich zu duschen. Dann verlange ich nach drei Tagen endlich neue Bettwäsche. Bis al es frisch bezogen ist, will ich ein paar Schritte laufen. Auf der Straße ist mir schwindlig, doch ich will es schaffen. Wir gehen vielleicht fünfzig Meter, und mir scheint, es wären fünf Kilometer. Ich muß zurück, denn der Gestank der Straße läßt meinem Magen keine Ruhe. Dennoch bin ich stolz auf meine Leistung. Ich verspreche Lketinga, daß wir morgen Nairobi verlassen werden. Als ich wieder erschöpft im Bett liege, wünsche ich mir, zu Hause bei meiner Mutter in der Schweiz zu sein.
Morgens bringt uns ein Taxi zur Busstation. Lketinga ist beunruhigt, weil er glaubt, wir ließen den anderen zurück. Aber nach zwei Tagen Wartezeit ist es wohl unser Recht abzureisen, da auch Lketingas Fest immer näherrückt. Die Fahrt nach Isiolo dauert ewig. Lketinga muß mich stützen, damit ich in den Kurven nicht kraftlos vom Sitz falle. In Isiolo schlägt Lketinga vor, hier zu übernachten, doch ich will nach Hause. Wenigstens nach Maralal möchte ich, vielleicht sehe ich Jutta oder Sophia.
Ich schleppe mich zur Mission und steige ins Fahrzeug, während sich Lketinga bei den Missionaren verabschiedet. Er will ans Steuer, aber das kann ich nicht verantworten. Wir sind in einer kleineren Stadt, und es wimmelt von Straßenkontrollen.
Ich fahre los und schaffe kaum, das Kupplungspedal durchzudrücken. Die ersten paar Kilometer sind noch asphaltiert, dann beginnt die Naturstraße. Unterwegs halten wir an und nehmen drei Samburus mit, die nach Wamba wol en. Beim Fahren denke ich an nichts mehr und konzentriere mich nur auf die Straße. Die Schlaglöcher erkenne ich schon von weitem. Was im Fahrzeug geschieht, nehme ich nicht wahr.
Erst als jemand eine Zigarette anzündet, verlange ich, sie sofort zu löschen, sonst muß ich brechen. Ich spüre, wie mein Magen rebelliert. Nur jetzt nicht anhalten und kotzen, das kostet zu viel Energie. Der Schweiß läuft mir am Körper herunter.
Ständig wische ich mir mit dem Handrücken über die Stirn, damit er mir nicht in die Augen tropft. Endlos dahinfahrend wende ich meine Augen keine Sekunde von der Straße ab.
Es wird Abend, und Lichter tauchen auf, wir sind in Maralal. Ich kann es kaum glauben, denn ich fuhr ohne jedes Zeitgefühl, und parke sofort bei unserem Lodging.
Ich stelle den Motor ab und schaue Lketinga an. Dabei merke ich, wie leicht mein Körper wird, und dann ist al es dunkel.
Im Spital
Ich öffne die Augen und glaube, aus einem bösen Traum zu erwachen. Doch um mich blickend, merke ich, daß das Schreien und Stöhnen Wirklichkeit ist. Ich liege im Spital und befinde mich in einem riesigen Raum, in dem Bett an Bett steht. Links von mir liegt eine alte, ausgemergelte Samburu-Frau. Rechts von mir steht ein rosarotes Kinderbett mit Gitter. Darinnen schlägt etwas ständig ans Holz und schreit. Wo ich hinschaue, nichts als Elend. Warum bin ich im Spital? Ich verstehe nicht, wie ich hierher gekommen bin. Wo ist Lketinga? Panik ergreift mich. Wie lange bin ich schon hier? Draußen ist es hell, die Sonne scheint. Mein Bett ist ein Eisengestel mit dünner Matratze und schmuddligen, gräulichen Bettlaken.
Zwei junge Mediziner in weißen Kitteln gehen vorbei. „Hello!“ Ich winke. Meine Stimme ist nicht laut genug. Das Gestöhne übertönt mich, und aufrichten kann ich mich nicht. Mein Kopf ist zu schwer. Tränen schießen mir in die Augen. Was soll das hier? Wo ist Lketinga?
Die Samburu-Frau spricht mit mir, doch ich verstehe nichts. Dann endlich sehe ich Lketinga auf mich zukommen. Sein Anblick beruhigt mich und macht mich sogar etwas froh. „Hello, Corinne, how you feel now?“
Ich versuche zu lächeln und sage, nicht schlecht. Er berichtet mir, daß ich gleich nach unserer Ankunft ohnmächtig geworden bin. Unsere Zimmerwirtin hat sofort den Krankenwagen alarmiert. Und nun sei ich seit gestern abend hier. Er sei die ganze Nacht bei mir gewesen, doch ich sei nicht aufgewacht. Ich kann kaum glauben, daß ich von al em nichts mitbekommen habe. Der Arzt hat mir eine Spritze gegeben.
Nach einer Weile stehen die beiden einheimischen Mediziner neben dem Bett. Ich habe eine akute Malaria, doch machen können sie nicht viel, da es an Medikamenten fehlt. Lediglich Pil en geben sie mir. Ich solle viel essen und schlafen. Allein bei dem Wort Essen wird mir übel, und schlafen bei diesem Gestöhne und Kindergeschrei scheint mir auch unmöglich. Lketinga sitzt am Bettrand und schaut mich hilflos an.
Plötzlich steigt mir ein penetranter Geruch von Kohl in die Nase. Mein Magen dreht sich. Ich brauche irgendeinen Behälter. In meiner Verzweiflung greife ich zum Wasserkrug und erbreche mich. Lketinga hält den Krug und stützt mich, al ein würde ich es kaum schaffen. Sogleich steht eine dunkle Krankenschwester neben uns, reißt mir den Krug weg und ersetzt diesen durch einen Kübel. „Why you make this? This is for drinking water!“
schnauzt sie mich an. Ich fühle mich elend. Der Geruch kommt vom Essenswagen.
Auf diesem stehen Blechnäpfe, in die eine Reis-Kohlmasse gefüllt wird. An jedem Bett wird ein Napf abgestellt.
Völ ig erschöpft vom Erbrechen, liege ich auf der Pritsche und halte mir mit dem Arm die Nase zu. Ich kann unmöglich essen. Vor etwa einer Stunde habe ich die ersten Tabletten bekommen, und langsam juckt es mich am ganzen Körper. Wie wild kratze ich überall. Lketinga bemerkt in meinem Gesicht Flecken und Pickel. Ich hebe meinen Rock, und wir entdecken, daß die Beine ebenfalls mit Pusteln übersät sind.
Er holt einen Arzt.
Offensichtlich reagiere ich auf das Medikament allergisch.
Doch er kann mir im Moment nichts anderes geben, da alles verbraucht ist und sie täglich auf Nachschub aus Nairobi hoffen.
Gegen Abend verläßt mich Lketinga. Er will etwas essen gehen und schauen, ob er jemanden von zu Hause trifft, um zu erfahren, wann sein großes Fest beginnt.
Todmüde möchte ich nur noch schlafen. Mein ganzer Körper ist in Schweiß gebadet, und das Fieberthermometer zeigt einundvierzig Grad. Vom vielen Wassertrinken verspüre ich das Bedürfnis nach einer Toilette. Aber wie komme ich nur dahin? Das Toilettenhäuschen befindet sich etwa dreißig Meter vom Eingang entfernt. Wie soll ich diese Strecke schaffen? Langsam stel e ich die Beine auf den Boden und steige in meine Plastiksandalen. Dann ziehe ich mich am Bettgestel hoch. Meine Beine zittern, ich kann kaum stehen. Ich reiße mich zusammen, denn ich will auf keinen Fal jetzt zusammenbrechen. Von Bett zu Bett Halt suchend, erreiche ich den Ausgang. Die dreißig Meter erscheinen mir unendlich weit, und ich bin versucht, die letzten Meter zu kriechen, da ich mich nirgends festhalten kann. Ich beiße die Zähne zusammen und erreiche mit letzter Kraft das Klo. Doch hier kann man nicht sitzen, im Gegenteil, ich muß in die Hocke. So gut es geht, halte ich mich an den Steinwänden fest.
Die ganze Tragik dieser Malaria wird mir bewußt, als ich realisiere, wie schwach ich bin, ich, die ich noch nie richtig krank war. Vor der Tür steht eine hochschwangere Massai-Frau. Als sie bemerkt, daß ich die Türe nicht loslasse, weil ich sonst hinfal en würde, hilft sie mir wortlos bis zum Eingang zurück. Ich bin ihr so dankbar, daß mir Tränen übers Gesicht laufen. Mühsam schleppe ich mich zurück ins Bett und heule vor mich hin. Die Schwester kommt und fragt, ob ich Schmerzen habe. Ich schüttle den Kopf und fühle mich noch elender. Irgendwann schlafe ich ein.
In der Nacht erwache ich. Das Kind im Gitterbett schreit furchtbar und schlägt mit dem Kopf an das Gitter. Es kommt niemand, und ich werde fast verrückt. Nun bin ich schon vier Tage hier, und mir geht es miserabel. Lketinga kommt häufig vorbei. Auch er sieht schlecht aus, er wil nach Hause, aber nicht ohne mich, da er Angst hat, ich sterbe. Außer Vitamintabletten habe ich immer noch nichts gegessen. Die Schwestern schimpfen ständig mit mir, doch jedesmal übergebe ich mich, wenn ich etwas in den Mund stecke. Mein Bauch schmerzt wahnsinnig. Einmal bringt mir Lketinga ein ganzes Ziegenbein, schön gebraten, und bittet verzweifelt, es zu essen, dann würde ich wieder gesund. Doch ich kann nicht. Enttäuscht geht er.