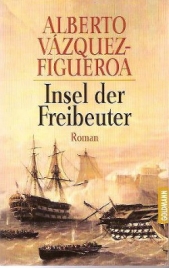Das Parfum

Das Parfum читать книгу онлайн
Von Jean-Baptiste Grenouille, dem finsteren Helden, sei nur verraten, da? er am 17. Juli 1738 in Paris, in einer stinkigen Fischbude geboren wird. Die Ammen, denen das Kerlchen an die Brust gelegt wird, halten es nur ein paar Tage mit ihm aus: Er sei zu gierig, au?erdem vom Teufel besessen, wof?r es untr?gliche Indizien gebe: den fehlenden Duft, den unverwechselbaren Geruch, den S?uglinge auszustr?men pflegen. Eine wundersame Eigenschaft, zu der sich alsbald andere dazugesellen… Wir beginnen zu ahnen, was es mit Grenouille auf sich haben k?nnte, fangen an, ihn leibhaftig vor uns zu sehen, folgen ihm in gemessenem Abstand auf seinen Wegen durch die dunkelsten Gassen von Paris, schauen zu, wie er dem Parfumeur Baldini zur Hand geht – und m?ssen uns eingestehen, die Phantasie, den Sprachwitz, den nicht anderes als ungeheuerlich zu nennenden erz?hlerischen Elan S?skinds weit untersch?tzt zu haben: so ?berraschend geht es zu in seinem Buch, so m?rchenhaft mitunter und zugleich so f?rchterlich angsteinfl??end.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Als Grenouille ans Fenster trat, verstummte das Gebrüll. Es war mit einem Mal so vollständig still wie an einem heißen Sommertag zur Mittagsstunde, wenn alles draußen auf den Feldern ist oder sich in den Schatten der Häuser verkriecht. Kein Tritt, kein Räuspern, kein Atmen war mehr zu hören. Die Menge war nur noch Auge und offener Mund, minutenlang. Kein Mensch konnte es fassen, dass der windige, kleine, geduckte Mann dort oben am Fenster, dieses Würstchen, dieses armselige Häuflein, dieses Nichts, über zwei Dutzend Morde begangen haben sollte. Er sah einem Mörder einfach nicht gleich. Niemand hätte zwar sagen können, wie er sich den Mörder, diesen Teufel, eigentlich vorgestellt hatte, aber alle waren sich einig: so nicht! Und dennoch – obwohl der Mörder den Vorstellungen der Leute so gar nicht entsprach und seine Präsentation daher, wie man würde meinen können, wenig überzeugend hätte wirken sollen, ging paradoxerweise allein von der Leibhaftigkeit dieses Menschen am Fenster und von der Tatsache, dass eben nur er und kein anderer als Mörder präsentiert wurde, eine überzeugende Wirkung aus. Sie dachten alle: Das kann doch nicht wahr sein! – und wussten im selben Moment, dass es wahr sein müsse.
Freilich, erst als die Wachen das Männlein wieder zurück ins Dunkel des Zimmers gezogen hatten, erst als es also nicht mehr gegenwärtig und sichtbar, sondern nur noch, wenn auch für kürzeste Zeit, als Erinnerung, fast möchte man sagen als Begriff in den Hirnen der Menschen existierte, als Begriff eines abscheulichen Mörders – da erst wich die Verblüffung der Menge und schaffte Raum für eine angemessene Reaktion: Die Münder klappten zu, die tausend Augen belebten sich wieder. Und dann erscholl es in einem einzigen donnernden Wut- und Racheschrei: »Wir wollen ihn haben!« Und sie schickten sich an, die Prévoté zu stürmen, um ihn mit eigenen Händen zu erwürgen, zu zerreißen und zu zerstückeln. Die Wachen hatten alle Mühe, das Tor zu verrammeln und den Mob zurückzudrängen. Grenouille wurde schleunigst in sein Verlies gebracht. Der Präsident trat ans Fenster und versprach ein schnelles und exemplarisch strenges Verfahren. Trotzdem dauerte es noch Stunden, ehe sich die Menge verlaufen, noch Tage, eh sich die Stadt leidlich beruhigt hatte.
In der Tat ging der Prozess gegen Grenouille äußerst zügig vonstatten, da nicht nur die Beweismittel erdrückend waren, sondern der Angeklagte selbst bei den Vernehmungen ohne Umschweife die ihm zur Last gelegten Morde gestand.
Allein nach seinen Motiven befragt, wusste er keine befriedigende Antwort zu geben. Er wiederholte immer nur, er habe die Mädchen gebraucht und sie deshalb erschlagen. Wozu er sie gebraucht habe und was das überhaupt bedeuten sollte, »er habe sie gebraucht« – dazu schwieg er. Man überantwortete ihn daraufhin der Folter, hängte ihn stundenlang an den Füßen auf, pumpte ihm sieben Finten Wasser ein, setzte Fußzwingen – ohne den geringsten Erfolg. Der Mensch schien gegen körperliche Schmerzen unempfindlich, gab keinen Laut von sich und sagte, wenn er abermals befragt wurde, nichts als: »Ich habe sie gebraucht. « Die Richter hielten ihn für geisteskrank. Sie setzten die Folter ab und beschlossen, das Verfahren ohne weitere Vernehmungen zu Ende zu bringen.
Die einzige Verzögerung, die sich noch ergab, war ein juristisches Geplänkel mit dem Magistrat von Draguignan, in dessen Vogtei La Napoule gelegen war, und dem Parlament in Aix, welche beide den Prozess an sich bringen wollten. Aber die Grasser Richter ließen sich die Sache nicht mehr entwinden. Sie waren es gewesen, die den Täter gefasst hatten, in ihrem Zuständigkeitsbereich war die überwiegende Anzahl der Morde begangen worden, und ihnen drohte der geballte Volkszorn, wenn sie den Mörder einem anderen Gericht überließen. Sein Blut musste in Grasse fließen.
Am 15. April 1766 wurde das Urteil gefällt und dem Angeklagten in seiner Zelle verlesen: »Der Parfumeurgeselle Jean-Baptiste Grenouille«, so hieß es da, »soll binnen achtundvierzig Stunden auf den Cours vor die Tore der Stadt geführt, dort, das Gesicht zum Himmel, auf ein Holzkreuz gebunden werden, bei lebendigem Leib zwölf Schläge mit einer eisernen Stange erhalten, die ihm die Gelenke der Arme, Beine, Hüften und Schultern zerschmettern, und danach auf dem Kreuze angeflochten aufgestellt werden bis zu seinem Tode.« Die übliche Gnadenpraxis, den Delinquenten nach dem Zerschmettern mittels eines Fadens zu erwürgen, wurde dem Scharfrichter ausdrücklich untersagt, auch wenn der Todeskampf sich über Tage hinziehen sollte. Die Leiche sei nächtens auf dem Schindanger zu vergraben, der Ort nicht zu kennzeichnen.
Grenouille nahm den Spruch ohne Regung entgegen. Der Gerichtsdiener fragte ihn nach seinem letzten Wunsch. »Nichts«, sagte Grenouille; er habe alles, was er brauche.
Ein Priester ging in die Zelle, um ihm die Beichte abzunehmen, kam aber schon nach einer Viertelstunde unverrichteter Dinge wieder heraus. Der Verurteilte habe ihn bei der Erwähnung des Namens Gottes so absolut verständnislos angeschaut, als höre er diesen Namen soeben zum ersten Mal, sich dann auf seiner Pritsche ausgestreckt, um sofort in tiefsten Schlaf zu versinken. Jedes weitere Wort sei sinnlos gewesen.
In den folgenden zwei Tagen kamen viele Menschen, um den berühmten Mörder aus der Nähe zu sehen. Die Wärter ließen sie durch die Klappe an der Zellentüre einen Blick tun und verlangten sechs Sol pro Blick. Ein Kupferstecher, der eine Skizze anfertigen wollte, musste zwei Franc bezahlen. Das Motiv war aber eher enttäuschend. Der Gefangene, an Fuß- und Handgelenken angekettet, lag die ganze Zeit auf der Pritsche und schlief. Das Gesicht hatte er zur Wand gekehrt, und er reagierte weder auf Klopfzeichen noch auf Zurufe. Der Zutritt zur Zelle war Besuchern strikt verwehrt, und die Wärter wagten es trotz verlockender Angebote nicht, sich über dies Verbot hinwegzusetzen. Man fürchtete, der Gefangene könne von einem Angehörigen seiner Opfer zur Unzeit ermordet werden. Aus dem gleichen Grund durfte ihm auch kein Essen zugeschoben werden. Es hätte vergiftet sein können. Während der ganzen Gefangenschaft erhielt Grenouille sein Essen aus der Gesindeküche des bischöflichen Palastes, welches der Gefängnisoberaufseher vorzukosten hatte. Die letzten beiden Tage aß er freilich gar nichts. Er lag und schlief. Gelegentlich klirrten seine Ketten, und wenn der Wärter an die Türklappe eilte, konnte er ihn einen Schluck aus der Wasserflasche nehmen, sich wieder aufs Lager werfen und weiterschlafen sehen. Es schien, als sei dieser Mensch seines Lebens derart müde, dass er nicht einmal mehr die letzten Stunden davon in wachem Zustand miterleben wollte.
Unterdessen wurde der Cours für die Hinrichtung vorbereitet. Zimmerleute bauten ein Schafott, drei mal drei Meter groß und zwei Meter hoch, mit Geländer und einer soliden Treppe – ein so prächtiges hatte man in Grasse noch nie gehabt. Dazu eine Holztribüne für die Honoratioren und einen Zaun gegen das gemeine Volk, das in gewisser Distanz gehalten werden sollte. Die Fensterplätze in den Häusern links und rechts der Porte du Cours und im Gebäude der Wache waren längst zu exorbitanten Preisen vermietet. Sogar in der etwas seitwärts gelegenen Charité hatte der Gehilfe des Scharfrichters den Kranken ihre Zimmer abgehandelt und mit hohem Gewinn an Schaulustige weitervermietet. Die Limonadenverkäufer mischten kannenweise Lakritzenwasser auf Vorrat, der Kupferstecher druckte seine im Gefängnis genommene und aus der Phantasie noch ein wenig rasanter gestaltete Skizze des Mörders in vielen hundert Exemplaren, fliegende Händler strömten zu Dutzenden in die Stadt, die Bäcker buken Gedenkplätzchen.
Der Scharfrichter, Monsieur Papon, der schon seit Jahren keinen Delinquenten mehr zu zerbrechen gehabt hatte, ließ sich eine schwere vierkantige Eisenstange schmieden und ging damit in den Schlachthof, um an Tierkadavern seine Hiebe zu üben. Zwölf Schläge durfte er nur führen, und mit diesen mussten die zwölf Gelenke sicher zerbrochen werden, ohne dass wertvolle Teile des Körpers, wie etwa Brust oder Kopf, beschädigt würden – ein diffiziles Geschäft, das größtes Fingerspitzengefühl erforderte.
Die Bürger bereiteten sich auf das Ereignis wie auf einen hohen Festtag vor. Dass nicht gearbeitet werden würde, verstand sich von selbst. Die Frauen bügelten ihr Feiertagshabit, die Männer staubten ihre Röcke aus und ließen sich die Stiefel glänzend putzen. Wer eine Militärcharge oder ein Amt besaß, wer Gildenmeister war, Advokat, Notar, Direktor einer Bruderschaft oder sonst etwas Bedeutendes, der legte Uniform und offizielle Tracht an, mit Orden, Schärpen, Ketten und mit kreideweiß gepuderter Perücke. Die Gläubigen gedachten sich post festum zum Gottesdienst zu versammeln, die Satansjünger zu einer deftigen luziferischen Dankmesse, die gebildete Noblesse zur magnetischen Seance in den Hotels der Cabris', Villeneuves und Fontmichels. In den Küchen wurde schon gebacken und gebraten, aus den Kellern Wein geholt und vom Markt der Blumenschmuck, in der Kathedrale probten Organist und Kirchenchor.
Im Hause Richis an der Rue Drohe blieb es still. Richis hatte sich jede Zurüstung für den »Tag der Befreiung«, als welchen das Volk den Hinrichtungstag des Mörders bezeichnete, verbeten. Ihm war alles ein Ekel. Die plötzlich wiederaufbrechende Furcht der Menschen war ihm ein Ekel gewesen, ihre fiebrige Vorfreude war ihm ein Ekel. Sie selbst, die Menschen, alle miteinander, waren ihm ein Ekel. Er hatte sich nicht an der Präsentation des Täters und seiner Opfer auf dem Platz vor der Kathedrale beteiligt, nicht am Prozess, nicht am widerwärtigen Defilee der Sensationslüsternen vor der Zelle des Verurteilten. Zur Identifikation der Haare und Kleider seiner Tochter hatte er das Gericht zu sich nach Hause bestellt, kurz und gefasst seine Aussage gemacht und gebeten, man möge ihm die Dinge als Reliquien überlassen, was auch geschah. Er trug sie in Laures Kammer, legte das zerschnittene Nachthemd und das Leibchen auf ihr Bett, breitete die roten Haare übers Kissen und setzte sich davor und verließ die Kammer Tag und Nacht nicht mehr, als wolle er durch diese sinnlose Wache gutmachen, was er in der Nacht von La Napoule versäumt hatte. Er war so erfüllt von Ekel, Ekel vor der Welt und vor sich selbst, dass er nicht weinen konnte.
Auch vor dem Mörder empfand er Ekel. Er wollte ihn nicht mehr als Menschen sehen, nur noch als Opfer, das geschlachtet würde. Erst bei der Hinrichtung wollte er ihn sehen, wenn er auf dem Kreuz lag und die zwölf Schläge auf ihn niederkrachten, dann wollte er ihn sehen, ganz nah wollte er ihn dann sehen, er hatte sich einen Platz in vorderster Reihe reservieren lassen. Und wenn sich das Volk verlaufen hätte, nach ein paar Stunden, dann wollte er hinaufsteigen zu ihm aufs Blutgerüst und sich neben ihn setzen und Wache halten, nächtelang, tagelang, wenn es sein musste, und ihm dabei in die Augen schauen, dem Mörder seiner Tochter, und ihm den ganzen Ekel in die Augen träufeln, der in ihm war, den ganzen Ekel in seinen Todeskampf hineinschütten wie eine brennende Säure, so lange, bis das Ding verreckt war…