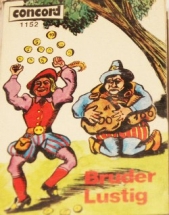Elf Minuten

Elf Minuten читать книгу онлайн
Wie ber?hrt man die Seele? Durch Liebe oder durch Lust? Kann man die Seele wie einen K?rper ber?hren und umgekehrt? Ein provozierendes modernes M?rchen ?ber die Alchimie der Liebe.
Paulo Coelho, geboren 1947 in Rio de Janeiro, Studium der Rechtswissenschaften, danach Reisen nach S?damerika, Europa und Nordafrika. Zur?ck in Brasilien, Ver?ffentlichung von Theaterst?cken und provokativer Rocksongs, die ihm ?ber die Militarjunta der 70er Jahre dreimal ins Gef?ngnis einbrachten. Er ist Herausgeber einer Untergrundzeitschrift, eines Musikmagazins sowie Direktor von Polygram und CBS, Brasilien. Ab 1980 (Stellenverlust) 5 Jahre Studium in einem alten spanischen Orden und Zur?cklegung des Pilgerwegs nach Santiago de Compostela. 2006 wurde Paulo Coelho mit dem mexikanischen Literaturpreis »Las Pergolas« ausgezeichnet.
Maralde Meyer-Minnemann, geboren 1943 in Hamburg, lebt heute als ?bersetzerin in Hamburg. 1997 erhielt sie den Hamburger F?rderpreis f?r literarische ?bersetzungen, 1997 den Preis Portugal-Frankfurt, 1998 den Helmut-M.-Braem-Preis.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Im allgemeinen ereignen sich diese Begegnungen, wenn wir an eine Grenze gelangen, wenn wir emotional sterben und wiedergeboren werden müssen. Die Begegnungen warten auf uns – aber meistens versuchen wir zu verhindern, daß sie sich ereignen. Wenn wir verzweifelt sind und nichts mehr zu verlieren haben oder wenn wir begeistert sind, dann manifestiert sieb das Unbekannte, und unser Universum ändert seine Wegrichtung.
Alle können lieben, denn sie wurden mit dieser Gabe geboren. Einige Menschen lieben von Anfang an richtig, aber die meisten müssen es erst wieder lernen, müssen sich daran erinnern, wie man liebt, und ausnahmslos alle müssen auf dem Scheiterhaufen ihrer vergangenen Gefühle brennen und Freuden und Schmerzen, Höhen und Tiefen wiedererleben, bis sie den roten Faden erkennen, der unsere Begegnungen miteinander verknüpft; ja, es gibt diesen roten Faden.
Und dann lernen die Körper die Sprache der Seele: Sex. Damit kann ich mich bei dem Mann revanchieren, der mir meine Seele zurückgegeben hat, obwohl er nicht weiß, wie wichtig er für mein Leben geworden ist. Er hat mich darum gebeten, und ich werde es ihm geben; ich möchte, daß er sehr glücklich wird.
Manchmal ist das Leben geizig: man verbringt Tage, Wochen, Monate und Jahre, ohne etwas Neues zu fühlen. Und dann öffnet sich plötzlich – wie bei Maria mit Ralf eine Tür, und in den offenen Raum stürzt eine wahre Lawine. In einem Augenblick hat man gar nichts und im nächsten mehr, als man ertragen kann.
Zwei Stunden später ging Maria ins ›Copacabana‹. Milan sprach sie an: »Du bist also mit dem Maler weggegangen.«
Ralf war im Hause offenbar kein Unbekannter – das hatte sie schon gedacht, als er für drei Freier bezahlt hatte, noch dazu gleich den richtigen Betrag, ohne nach dem Preis zu fragen. Maria nickte vielsagend, aber Milan, der ein alter Hase war, ließ sich von ihr nicht täuschen.
»Vielleicht bist du ja für den nächsten Schritt bereit. Einer der speziellen Freier fragt immer nach dir. Ich habe ihm gesagt, daß du keine Erfahrung hast, und er hat mir geglaubt; aber vielleicht ist ja die Zeit reif für einen Versuch.«
›Spezieller Freier?‹
»Und was hat das mit dem Maler zu tun?«
»Er ist auch ein spezieller Freier.«
Also hatten ihre Kolleginnen alles, was sie mit Ralf Hart gemacht hatte, schon durchexerziert. Sie biß sich auf die Lippe und sagte nichts – sie hatte eine schöne Woche gehabt, konnte nicht vergessen, was sie geschrieben hatte.
»Soll ich dasselbe machen wie mit ihm?«
»Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt; aber wenn dich heute abend jemand auf einen Drink einlädt, sag nein. Die speziellen Freier zahlen besser. Du wirst sehen: Du wirst es nicht bereuen.«
Der Abend begann wie immer. Die Thailänderinnen steckten wie üblich die Köpfe zusammen, die Kolumbianerinnen spielten die Welterfahrenen, während Maria und die zwei anderen Brasilianerinnen scheinbar blasiert in einer Ecke lehnten. Es gab noch eine Österreicherin, zwei Deutsche. Der Rest waren Frauen aus dem ehemaligen Ostblock, alle hübsch, großgewachsen und blauäugig – sie wurden immer schneller als die anderen weggeheiratet.
Die Männer kamen – Russen, Schweizer, Deutsche, zumeist vielbeschäftigte Manager, die sich die teuersten Prostituierten einer der teuersten Städte der Welt leisten konnten. Einige wandten sich zu Marias Tisch, aber sie hielt den Blick auf Milan gerichtet, und der schüttelte nur immer wieder den Kopf. Maria war zufrieden: sie wollte in dieser Nacht nicht die Beine breitmachen, schlecht riechende Männer in ihre Hotels begleiten; sie wollte nur einem sexüberdrüssigen Mann beibringen, wie man Liebe macht. Und keine andere Frau als sie hatte die notwendige Phantasie, um die Geschichte der Gegenwart neu zu erfinden.
Gleichzeitig fragte sie sich: ›Warum wollen diese Männer, nach all ihren Erfahrungen, zum Anfang zurückkehren?‹ Nun, das war nicht ihr Problem; solange sie gut zahlten, war sie bereit, sie zu bedienen.
Ein Mann, jünger als Ralf, kam herein; gutaussehend, schwarzhaarig, perfekte Zähne, in einem Anzug mit Stehkragen, der irgendwie chinesisch wirkte – ohne Krawatte, darunter ein makellos weißes Hemd. Er ging an die Bar zu Milan, der zu Maria herübersah. Der Mann kam auf sie zu.
»Darf ich Ihnen einen Drink spendieren?«
Milan nickte, und Maria lud den Mann ein, sich zu ihr an den Tisch zu setzen. Sie bestellte ihren Fruchtcocktail und wartete darauf, daß er sie zum Tanzen aufforderte.
»Ich heiße Terence«, stellte er sich vor. »Ich arbeite bei einer Plattengesellschaft in England. Da ich weiß, daß ich in einem vertrauenswürdigen Lokal bin, kann ich hoffentlich davon ausgehen, daß das unter uns bleibt.«
Maria fing gerade an, von Brasilien zu erzählen, als er sie unterbrach: »Milan sagt, du würdest verstehen, was ich will.«
»Ich weiß nicht, was Sie wollen. Aber ich verstehe etwas von dem, was ich mache.«
Das Ritual wurde nicht eingehalten; er bezahlte die Rechnung, nahm sie beim Arm, sie stiegen in ein Taxi, und er reichte ihr tausend Franken. Maria mußte kurz an den Araber denken, mit dem sie in dem Restaurant mit den vielen berühmten Bildern zu Abend gegessen hatte; heute erhielt sie zum ersten Mal wieder diesen Betrag, doch statt sich darüber zu freuen, wurde sie nervös.
Das Taxi hielt vor einem der teuersten Hotels der Stadt. Der Mann grüßte den Portier, zeigte, daß er mit dem Hotel vertraut war. Sie gingen direkt auf sein Zimmer, eine Suite mit Blick auf den Fluß. Er öffnete eine Flasche Wein – bestimmt ein alter Jahrgang – und bot Maria ein Glas an.
Im Trinken beobachtete sie ihn. Wieso holte sich ein so gutaussehender, wohlhabender Mann eine Prostituierte?
Da er fast nichts sagte, schwieg auch sie die meiste Zeit und versuchte sich auszumalen, was einen speziellen Freier zufriedenstellen könnte. Ihr war klar, daß sie nicht die Initiative ergreifen durfte, aber sie würde mitmachen. Schließlich bot sich nicht jede Nacht die Gelegenheit, tausend Franken zu verdienen.
»Wir haben Zeit«, sagte Terence. »Alle Zeit, die wir brauchen. Du kannst hier schlafen, wenn du willst.«
Ihre Unsicherheit kehrte zurück. Der Mann wirkte keineswegs eingeschüchtert und redete mit ruhiger Stimme, er war anders als alle anderen. Er wußte, was er wollte; er legte zum richtigen Zeitpunkt die richtige Musik im richtigen Zimmer mit dem richtigen Ausblick auf. Sein Anzug war gut geschnitten, der Koffer, der in einer Ecke stand, war klein, als brauchte er nicht viel zum Reisen – oder als wäre er nur für die eine Nacht nach Genf gekommen.
»Ich werde zu Hause schlafen«, entgegnete Maria.
Der Mann, der vor ihr stand, veränderte sich vollkommen. Seine Gentlemanaugen funkelten plötzlich kalt. »Setz dich hin«, sagte er und wies auf einen Stuhl neben dem Schreibtisch.
Das war ein Befehl! Ein regelrechter Befehl. Maria gehorchte, und merkwürdigerweise fand sie das erregend.
»Setz dich gerade hin. Streck den Rücken wie eine Klassefrau. Sonst wirst du gezüchtigt.«
Züchtigen! ›Spezieller Freier‹! Maria schaltete sofort, holte die tausend Franken aus der Handtasche und legte sie auf den Schreibtisch.
»Ich weiß, was Sie wollen.« Sie blickte ihm tief in die kalten, blauen Augen. »Und ich bin nicht bereit dazu.«
Der Mann schien wieder der alte zu werden. Offenbar sah er ihr an, daß sie es ernst meinte. »Trink deinen Wein«, sagte er. »Ich werde dich zu nichts zwingen. Du kannst noch ein bißchen bleiben oder schon gehen, ganz wie du willst.«
Das beruhigte sie etwas.
»Ich habe eine Arbeit. Ich habe einen Chef, der mich protegiert und an mich glaubt. Bitte, sagen Sie ihm nichts!«
Maria sagte das weder weinerlich noch bittend – es war schlicht ihre Lebenswirklichkeit.
Terence war auch wieder der Mann von vorher geworden weder weich noch hart, nur jemand, der im Gegensatz zu den anderen Freiern den Eindruck machte, daß er wußte, was er wollte. Jetzt schien er wie aus einer Trance zu erwachen, aus einer Rolle in einem Theaterstück herauszutreten, das noch nicht begonnen hatte.
Lohnte es sich, einfach wegzugehen, ohne die Wahrheit über den ›speziellen Freier‹ zu ergründen?
»Was genau wollen Sie?«
»Du weißt es. Schmerz. Leiden. Und viel Lust.«
›Was haben Schmerz und Leiden mit Lust zu tun?‹ überlegte Maria. Obwohl sie unbedingt glauben wollte, daß es sehr wohl so war, und damit einen großen Teil der negativen Erfahrungen in ihrem Leben ins Positive zu wenden.
Er nahm sie bei der Hand und führte sie zum Fenster: auf der anderen Seite des Sees konnten sie die Türme der Kathedrale sehen – Maria erinnerte sich daran, daß sie dort vorbeigekommen war, als sie mit Ralf Hart den Jakobsweg entlanggegangen war.
»Siehst du diesen Fluß, diesen See, diese Häuser, diese Kirche? Vor fünfhundert Jahren war dies alles schon da. Nur die Stadt wirkte verlassen; eine unbekannte Krankheit hatte sich über ganz Europa ausgebreitet, und niemand wußte, weshalb so viele Menschen starben. Sie nannten die Krankheit den Schwarze Tod – eine Strafe, die Gott wegen der Sünden der Menschen auf die Welt geschickt hatte.
Da beschloß eine Gruppe Menschen, sich für die Menschheit zu opfern: Sie brachten dar, was sie am meisten fürchteten: den körperlichen Schmerz. Tag und Nacht gingen sie über diese Brücken, durch diese Straßen, geißelten ihre Körper mit Peitschen oder Ketten. Sie litten im Namen Gottes und lobten Gott mit ihren Schmerzen. Bald schon entdeckten sie, daß sie dabei glücklicher waren, als wenn sie Brot backten, auf dem Feld arbeiteten, ihr Vieh fütterten. Der Schmerz war kein Leiden mehr, sondern die Lust daran, die Menschheit von ihren Sünden zu erlösen. Der Schmerz verwandelte sich in Freude, in Lebensgefühl, in Lust.«
Seine Augen hatten denselben kalten Glanz wie kurz zuvor. Terence griff nach dem Geld, das sie auf den Schreibtisch gelegt hatte, nahm hundertfünfzig Franken davon und steckte sie in ihre Handtasche.
»Mach dir wegen deines Chefs keine Sorgen. Hier ist seine Kommission, und ich verspreche dir, ihm nichts zu sagen. Du kannst gehen.«
Sie nahm das ganze Geld.
»Nein!«
Es war der Wein, der Araber im Restaurant, die Frau mit dem traurigen Lächeln; es war die Vorstellung, nie wieder an jenen verdammten Ort zurückzukehren; es war die Angst vor der Liebe, die in der Gestalt eines Mannes in ihr Leben getreten war; es waren die Briefe an ihre Mutter, die von einem schönen Leben voller Arbeitsmöglichkeiten erzählten; es war der Junge, der sie in ihrer Kindheit um einen Bleistift gebeten hatte; es waren ihre Kämpfe mit sich selbst; es war Schuld, Neugier, Geld; es war ihre Suche nach den eigenen Grenzen, nach den verpaßten Chancen und Gelegenheiten. Eine andere Maria trat an ihre Stelle: Sie machte keine Geschenke, sondern gab sich als Opfer hin.