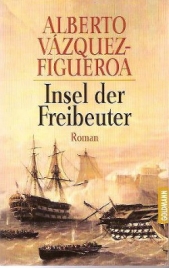Das Parfum

Das Parfum читать книгу онлайн
Von Jean-Baptiste Grenouille, dem finsteren Helden, sei nur verraten, da? er am 17. Juli 1738 in Paris, in einer stinkigen Fischbude geboren wird. Die Ammen, denen das Kerlchen an die Brust gelegt wird, halten es nur ein paar Tage mit ihm aus: Er sei zu gierig, au?erdem vom Teufel besessen, wof?r es untr?gliche Indizien gebe: den fehlenden Duft, den unverwechselbaren Geruch, den S?uglinge auszustr?men pflegen. Eine wundersame Eigenschaft, zu der sich alsbald andere dazugesellen… Wir beginnen zu ahnen, was es mit Grenouille auf sich haben k?nnte, fangen an, ihn leibhaftig vor uns zu sehen, folgen ihm in gemessenem Abstand auf seinen Wegen durch die dunkelsten Gassen von Paris, schauen zu, wie er dem Parfumeur Baldini zur Hand geht – und m?ssen uns eingestehen, die Phantasie, den Sprachwitz, den nicht anderes als ungeheuerlich zu nennenden erz?hlerischen Elan S?skinds weit untersch?tzt zu haben: so ?berraschend geht es zu in seinem Buch, so m?rchenhaft mitunter und zugleich so f?rchterlich angsteinfl??end.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Mit besonderem Eifer war er hingegen bei der Sache, wenn Baldini ihn im Anfertigen von Tinkturen, Auszügen und Essenzen unterwies. Unermüdlich konnte er Bittermandelkerne in der Schraubenpresse quetschen oder Moschuskörner stampfen oder fette graue Amberknollen mit dem Wiegemesser hacken oder Veilchenwurzeln raspeln, um die Späne dann in feinstem Alkohol zu digerieren. Er lernte den Gebrauch des Scheidetrichters kennen, mit welchem man das reine Öl gepresster Limonenschalen von der trüben Rückstandsbrühe trennte. Er lernte Kräuter und Blüten zu trocknen, auf Rosten in schattiger Wärme, und das raschelnde Laub in wachsversiegelten Töpfen und Truhen zu konservieren. Er erlernte die Kunst, Pomaden auszuwaschen, Infusionen herzustellen, zu filtrieren, zu konzentrieren, zu klarifizieren und zu rektifizieren.
Freilich war Baldinis Werkstatt nicht dazu geeignet, dass man darin in großem Stile Blüten- oder Kräuteröle fabrizierte. Es hätte in Paris ja auch die notwendigen Mengen frischer Pflanzen kaum gegeben. Gelegentlich jedoch, wenn frischer Rosmarin, wenn Salbei, Minze oder Anissamen am Markt billig zu haben waren oder wenn ein größerer Posten Irisknollen oder Baldrianwurzel, Kümmel, Muskatnuss oder trockne Nelkenblüte eingetroffen war, dann regte sich Baldinis Alchimistenader, und er holte seinen großen Alambic hervor, einen kupfernen Destillierbottich mit oben aufgesetztem Kondensiertopf – einen sogenannten Maurenkopfalambic, wie er stolz verkündete – , mit dem er schon vor vierzig Jahren an den südlichen Hängen Liguriens und auf den Höhen des Luberon auf freiem Felde Lavendel destilliert habe. Und während Grenouille das Destilliergut zerkleinerte, heizte Baldini in hektischer Eile – denn rasche Verarbeitung war das A und O des Geschäfts – eine gemauerte Feuerstelle ein, auf die er den kupfernen Kessel, mit einem guten Bodensatz Wasser gefüllt, postierte. Er warf die Pflanzenteile hinein, stopfte den doppelwandigen Maurenkopf auf den Stutzen und schloss zwei Schläuchlein für zu- und abfließendes Wasser daran an. Diese raffinierte Wasserkühlungskonstruktion, so erklärte er, sei erst nachträglich von ihm eingebaut worden, denn seinerzeit auf dem Felde habe man selbstverständlich mit bloßer zugefächelter Luft gekühlt. Dann blies er das Feuer an.
Allmählich begann es, im Kessel zu brodeln. Und nach einer Weile, erst zaghaft tröpfchenweise, dann in fadendünnem Rinnsal, floss Destillat aus der dritten Röhre des Maurenkopfs in eine Florentinerflasche, die Baldini untergestellt hatte. Es sah zunächst recht unansehnlich aus, wie eine dünne, trübe Suppe. Nach und nach aber, vor allem wenn die gefüllte Flasche durch eine neue ausgetauscht und ruhig beiseite gestellt worden war, schied sich die Brühe in zwei verschiedene Flüssigkeiten: unten stand das Blüten- oder Kräuterwasser, obenauf schwamm eine dicke Schicht von Öl. Goss man nun vorsichtig durch den unteren Schnabelhals der Florentinerflasche das nur zart duftende Blütenwasser ab, so blieb das reine Öl zurück, die Essenz, das starke riechende Prinzip der Pflanze. Grenouille war von dem Vorgang fasziniert. Wenn je etwas im Leben Begeisterung in ihm entfacht hatte freilich keine äußerlich sichtbare, sondern eine verborgene, wie in kalter Flamme brennende Begeisterung –, dann war es dieses Verfahren, mit Feuer, Wasser und Dampf und einer ausgeklügelten Apparatur den Dingen ihre duftende Seele zu entreißen. Diese duftende Seele, das ätherische Öl, war ja das Beste an ihnen, das einzige, um dessentwillen sie ihn interessierten. Der blöde Rest: Blüte, Blätter, Schale, Frucht, Farbe, Schönheit, Lebendigkeit und was sonst noch an Überflüssigem in ihnen steckte, das kümmerte ihn nicht. Das war nur Hülle und Ballast. Das gehörte weg.
Von Zeit zu Zeit, wenn das Destillat wässrig klar geworden war, nahmen sie den Alambic vom Feuer, öffneten ihn und schütteten das zerkochte Zeug heraus. Es sah schlapp aus und blass wie aufgeweichtes Stroh, wie gebleichte Knochen kleiner Vögel, wie Gemüse, das zu lang gekocht hat, fad und fasrig, matschig, kaum noch als es selbst erkenntlich, eklig leichenhaft und so gut wie vollständig des eigenen Geruchs beraubt. Sie warfen es zum Fenster hinaus in den Fluss. Dann beschickten sie mit neuen frischen Pflanzen, füllten Wasser nach und setzten den Alambic zurück auf die Feuerstelle. Und wieder begann der Kessel zu brodeln, und wieder rann der Lebenssaft der Pflanzen in die Florentinerflaschen. So ging es oft die ganze Nacht hindurch. Baldini besorgte den Ofen, Grenouille behielt die Flaschen im Auge, mehr war nicht zu tun in der Zeit zwischen den Wechseln.
Sie saßen auf Schemeln ums Feuer, im Banne des plumpen Bottichs, beide gebannt, wenn auch aus sehr verschiedenen Gründen. Baldini genoss die Glut des Feuers und das flackernde Rot der Flammen und des Kupfers, er liebte das Knistern des brennenden Holzes, das Gurgeln des Alambics, denn das war wie früher. Da konnte man ins Schwärmen kommen! Er holte eine Flasche Wein aus dem Laden, denn die Hitze machte ihn durstig, und Weintrinken, das war auch wie früher. Und dann fing er an, Geschichten zu erzählen, von damals, endlos. Vom spanischen Erbfolgekrieg, an dessen Verlauf er, gegen die Österreicher kämpfend, maßgeblich beteiligt gewesen sei; von den Camisards, mit denen er die Cevennen unsicher gemacht habe; von der Tochter eines Hugenotten im Esterei, die vom Lavendelduft berauscht ihm zu Willen gewesen sei; von einem Waldbrand, den er dabei um ein Haar entfacht und der dann wohl die gesamte Provence in Brand gesteckt hätte, so sicher wie das Amen in der Kirche, denn es ging ein scharfer Mistral; und vom Destillieren erzählte er, immer wieder davon, auf freiem Feld, nachts, beim Mondschein, bei Wein und bei Zikadengeschrei, und von einem Lavendelöl, das er dabei erzeugt habe, so fein und kräftig, dass man es ihm mit Silber auf gewogen habe; von seiner Lehrzeit in Genua, von seinen Wanderjahren und von der Stadt Grasse, in der es so viele Parfumeure gebe wie anderswo Schuster, und so reiche darunter, dass sie lebten wie Fürsten, in prächtigen Häusern mit schattigen Gärten und Terrassen und holzgetäfelten Esszimmern, in denen sie speisten von porzellanenen Tellern mit Goldbesteck, und so fort…
Solche Geschichten erzählte der alte Baldini und trank Wein dazu und bekam vom Wein und von der Feuerglut und von der Begeisterung über seine eignen Geschichten ganz feuerrote Bäckchen. Grenouille aber, der etwas mehr im Schatten saß, hörte gar nicht zu. Ihn interessierten keine alten Geschichten, ihn interessierte ausschließlich der neue Vorgang. Er starrte unausgesetzt auf das Röhrchen am Kopf des Alambics, aus dem in dünnem Strahl das Destillat rann. Und indem er es anstarrte, stellte er sich vor, er selbst sei so ein Alambic, in dem es brodele wie in diesem und aus dem ein Destillat hervorquelle wie hier, nur eben besser, neuer, ungewohnter, ein Destillat von jenen exquisiten Pflanzen, die er selbst in seinem Innern gezogen hatte, die dort blühten, ungerochen außer von ihm selbst, und die mit ihrem einzigartigen Parfum die Welt in einen duftenden Garten Eden verwandeln könnten, in welchem für ihn das Dasein olfaktorisch einigermaßen erträglich wäre. Ein großer Alambic zu sein, der alle Welt mit seinen selbsterzeugten Destillaten überschwemmte, das war der Wunschtraum, dem Grenouille sich hingab.
Während aber Baldini, vom Wein entzündet, immer ausschweifendere Geschichten davon erzählte, wie es früher gewesen war, und sich immer hemmungsloser in die eigenen Schwärmereien verstrickte, ließ Grenouille bald ab von seiner bizarren Phantasie. Er verbannte die Vorstellung vom großen Alambic fürs erste aus seinem Kopf und überlegte stattdessen, wie er sich seine neuerworbenen Kenntnisse für näherliegende Ziele nutzbar machen könnte.
19
Nicht lang, und er war ein Spezialist auf dem Gebiet des Destillierens. Er fand heraus – und seine Nase half ihm dabei mehr als Baldinis Regelwerk – , dass die Hitze des Feuers von entscheidendem Einfluss auf die Güte des Destillates war. Jede Pflanze, jede Blüte, jedes Holz und jede Ölfrucht verlangten eine besondere Prozedur. Mal musste schärfster Dampf entwickelt, mal nur mäßig stark gebrodelt werden, und manche Blüte gab ihr Bestes erst, wenn man sie auf kleinster Flamme schwitzen ließ.
Ähnlich wichtig war die Aufbereitung. Minze und Lavendel konnte man in ganzen Büscheln destillieren. Andres wollte fein verlesen sein, zerpflückt, gehackt, geraspelt, gestampft oder sogar als Maische angesetzt, bevor es in den Kupferkessel kam. Manches aber ließ sich überhaupt nicht destillieren, und das erbitterte Grenouille aufs äußerste.
Baldini hatte ihm, als er sah, wie sicher Grenouille die Apparatur beherrschte, freie Hand im Umgang mit dem Alambic gelassen, und Grenouille hatte diese Freiheit weidlich genutzt. Während er tagsüber Parfums mischte und sonstige Duft- und Würzprodukte fertigte, beschäftigte er sich nachts ausschließlich mit der geheimnisvollen Kunst des Destillierens. Sein Plan war, vollkommen neue Geruchsstoffe zu produzieren, um damit wenigstens einige der Düfte, die er in seinem Innern trug, herstellen zu können. Zunächst hatte er auch kleine Erfolge. Es gelang ihm, ein Öl von Brennesselblüten und von Kressesamen zu erzeugen, ein Wasser von der frischgeschälten Rinde des Holunder-Strauchs und von Eibenzweigen. Die Destillate ähnelten zwar im Duft den Ausgangsstoffen kaum noch, waren aber immerhin noch interessant genug, um für weitere Verarbeitung zu taugen. Dann allerdings gab es Stoffe, bei denen das Verfahren vollständig versagte. Grenouille versuchte etwa, den Geruch von Glas zu destillieren, den lehmig-kühlen Geruch glatten Glases, der von normalen Menschen gar nicht wahrzunehmen ist. Er besorgte sich Fensterglas und Flaschenglas und verarbeitete es in großen Stücken, in Scherben, in Splittern, als Staub – ohne den geringsten Erfolg. Er destillierte Messing, Porzellan und Leder, Korn und Kieselsteine. Schiere Erde destillierte er. Blut und Holz und frische Fische. Seine eigenen Haare. Am Ende destillierte er sogar Wasser, Wasser aus der Seine, dessen eigentümlicher Geruch ihm wert schien, aufbewahrt zu werden. Er glaubte, mit Hilfe des Alambics könne er diesen Stoffen ihren charakteristischen Duft entreißen, wie das bei Thymian, bei Lavendel und beim Kümmelsamen möglich war. Er wusste ja nicht, dass die Destillation nichts anderes war als ein Verfahren zur Trennung gemischter Substanzen in ihre flüchtigen und weniger flüchtigen Einzelteile und dass sie für die Parfumerie nur insofern von Nutzen war, als sie das flüchtige ätherische Öl gewisser Pflanzen von ihren duftlosen oder duftarmen Resten absondern konnte. Bei Substanzen, denen dieses ätherische Öl abging, war das Verfahren der Destillation natürlich völlig sinnlos. Uns heutigen Menschen, die wir physikalisch ausgebildet sind, leuchtet das sofort ein. Für Grenouille jedoch war diese Erkenntnis das mühselig errungene Ergebnis einer langen Kette von enttäuschenden Versuchen. Über Monate hinweg hatte er Nacht für Nacht am Alambic gesessen und auf jede erdenkliche Weise versucht, mittels Destillation radikal neue Düfte zu erzeugen, Düfte, wie es sie in konzentrierter Form auf Erden noch nicht gegeben hatte. Und bis auf ein paar lächerliche Pflanzenöle war nichts dabei herausgekommen. Aus dem tiefen, unermesslich reichen Brunnen seiner Vorstellung hatte er keinen einzigen Tropfen konkreter Duftessenz gefördert, von allem, was ihm geruchlich vorgeschwebt hatte, nicht ein Atom realisieren können.