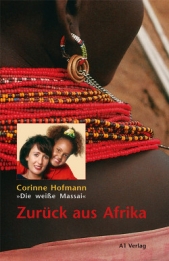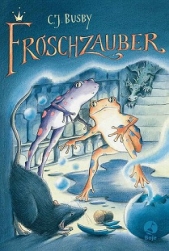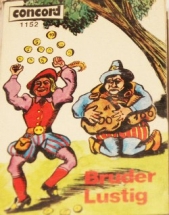Liebe Deinen Nachsten

Liebe Deinen Nachsten читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
20
Steiner kam morgens um elf Uhr an. Er ließ seinen Koffer in der Aufbewahrungsstelle für Gepäck und ging sofort zum Krankenhaus. Er sah die Stadt nicht; er sah nur etwas, das an ihm zu beiden Seiten vorbeitrieb, eine Flut von Häusern, Wagen und Menschen.
Vor dem großen, weißen Bau blieb er stehen. Er zögerte eine Weile. Er starrte auf das weite Portal und die endlosen Reihen der Fenster, Stock über Stock. Irgendwo dort – aber vielleicht auch nicht mehr. Er biß die Zähne zusammen und trat ein.
»Ich möchte mich erkundigen, wann Besuchsstunde ist«, sagte er im Anmeldebüro.
»Für welche Klasse?«fragte die Schwester.
»Das weiß ich nicht. Ich komme zum erstenmal.«
»Zu wem wollen Sie?«
»Zu Frau Marie Steiner.«
Steiner wunderte sich einen Augenblick, als die Schwester gleichgültig ein dickes Buch nachschlug. Er hatte fast erwartet, die weiße Halle müsse zusammenstürzen, oder die Schwester müsse aufspringen und jemand rufen, eine Wache oder Polizei, als er den Namen aussprach.
Die Schwester blätterte.»Patienten erster Klasse können jederzeit Besuch empfangen«, sagte sie, während sie suchte.
»Es wird nicht erster Klasse sein«, erwiderte Steiner.»Vielleicht dritter.«
»Für dritte Klasse ist Besuchsstunde von drei bis fünf.«
Die Schwester suchte und suchte.»Wie war doch der Name?«fragte sie.
»Steiner, Marie Steiner.«Steiner hatte plötzlich einen trockenen Hals. Er starrte die hübsche, puppenhafte Schwester an, als käme sein Todesurteil. Er wartete darauf, daß sie sagen würde: Gestorben.
»Marie Steiner«, sagte die Schwester,»zweite Klasse. Zimmer fünfhundertfünf, fünfter Stock. Besuchsstunde von drei bis sechs Uhr.«
»Fünfhundertfünf. Danke vielmals, Schwester.«
»Bitte, mein Herr!«
Steiner blieb stehen. Die Schwester griff nach dem summenden Telefon.»Haben Sie noch eine Frage, mein Herr?«
»Lebt sie noch?«fragte Steiner.
Die Schwester legte das Telefon nieder. In der Muschel quakte eine leise, blecherne Stimme weiter, als wäre das Telefon ein Tier.
»Natürlich, mein Herr«, sagte die Schwester und blickte in ihr Buch.»Sonst wäre doch ein Vermerk hinter ihrem Namen. Die Abgänge werden immer pünktlich gemeldet.«
»Danke.«
Steiner zwang sich, nicht zu fragen, ob er sofort hinaufgehen könne. Er fürchtete, daß man wissen wolle, weshalb, und er mußte jedes Aufsehen vermeiden. Deshalb ging er. Er wanderte ziellos durch die Straßen, immer wieder in größeren Kreisen am Hospital vorbei. Sie lebt, dachte er. Mein Gott, sie lebt! Dann überfiel ihn plötzlich die Angst, jemand könnte ihn erkennen, und er suchte eine abgelegene Kneipe, um dort zu warten. Er bestellte etwas zu essen, aber er konnte nichts hinunterkriegen.
Der Kellner sah ihn befremdet an.»Schmeckt es Ihnen nicht?«
»Doch, es ist gut. Aber bringen Sie mir vorher einen Kirsch.«
Er zwang sich, die Mahlzeit zu essen. Dann bestellte er sich eine Zeitung und Zigaretten. Er tat, als wenn er läse, und er wollte es auch. Aber nichts drang durch die Mauer seiner Stirn. Er saß in einem halbdunklen Raum, der nach Speisen und schalem vergossenem Bier roch, und erlebte die schrecklichsten Stunden seines Daseins. Er malte sich aus, daß Marie jetzt, in diesen Stunden, stürbe, er hörte ihre verzweifelten Rufe nach ihm, er sah ihr vom Todesschweiß überträntes Gesicht, und er saß bleiern auf seinem Stuhl, die Zeitung raschelnd vor den Augen, und biß die Zähne zusammen, um nicht zu stöhnen und aufzuspringen und fortzulaufen. Der kriechende Zeiger auf seiner Uhr war der Arm des Schicksals, der sein Leben staute und ihn fast ersticken ließ ob seiner Langsamkeit.
Er ließ endlich die Zeitung sinken und stand auf. Der Kellner lehnte an der Theke und stocherte in den Zähnen. Er kam heran, als er sah, daß der Gast sich erhob.»Zahlen?«fragte er.
»Nein«, sagte Steiner.»Noch einen Kirsch.«
»Gut.«Der Kellner schenkte ein.
»Nehmen Sie auch einen.«
»Können wir machen.«
Der Kellner goß noch ein Glas voll und hob es mit zwei Fingern an.
»Zur Gesundheit!«
»Ja«, sagte Steiner,»zur Gesundheit.«
Sie tranken und setzten die Gläser nieder.»Spielen Sie Billard?«fragte Steiner.
Der Kellner blickte auf den dunkelgrün ausgeschlagenen Tisch, der in der Mitte der Gaststube stand.»Etwas.«
»Wollen wir eine Partie machen?«
»Warum nicht? Spielen Sie gut?«
»Ich habe lange nicht gespielt. Wir können erst eine Probepartie machen, wenn Sie wollen.«
»Gemacht.«
Sie kreideten die Stöcke ein und spielten einige Bälle. Dann begannen sie eine Partie, die Steiner gewann.
»Sie spielen besser als ich«, sagte der Kellner.»Sie müssen mir zehn Punkte vorgeben.«
»Gut.«
Wenn ich diese Partie gewinne, wird alles gut, dachte Steiner. Sie lebt, ich sehe sie, sie wird vielleicht wieder gesund…
Er spielte konzentriert und gewann die Partie.»Jetzt gebe ich Ihnen zwanzig Punkte vor«, sagte er. Diese zwanzig Punkte waren Leben, Gesundheit und Flucht zusammen, und die weißen Bälle und ihr Klicken waren wie das Schnappen der Schlüssel des Schicksals. Das Spiel war hart. Der Kellner kam in einer guten Serie bis auf zwei Punkte an die volle Zahl heran; dann verfehlte er den letzten Ball um einen Zentimeter. Steiner nahm sein Queue und begann zu spielen. Die Augen flimmerten ihm, und er mußte einige Male pausieren; aber er kam ohne Fehlstoß zu Ende.
»Gut gespielt«, sagte der Kellner anerkennend.
Steiner nickte ihm dankbar zu und sah auf die Uhr. Es war nach drei. Rasch zahlte er und ging.
Er stieg die mit Linoleum belegten Stufen hinauf und war nichts mehr als ein einziges, ungeheuer hohes, rasendes Vibrieren. Der lange Gang bog und wellte sich, und dann sprang kreidig eine weiße Tür heraus, schob sich vor und stand still: fünfhundertfünf.
Steiner klopfte. Niemand antwortete. Er klopfte noch einmal. Sein Magen krampfte sich hoch in einer entsetzlichen Angst, daß jetzt noch etwas passieren könne. Er öffnete die Tür.
Das kleine Zimmer lag im Licht der Nachmittagssonne da wie eine Insel des Friedens aus einer andern Welt. Es schien, als hätte die hallende, vorwärts stürmende Zeit keine Gewalt mehr über die unendlich stille Gestalt, die in dem schmalen Bett lag und Steiner ansah. Er taumelte etwas, und sein Hut entfiel ihm. Er wollte sich bücken, ihn aufzuheben, aber mitten im Bücken brach es wie ein Schlag in seinen Rücken, und ohne zu wissen, was er getan hatte, kniete er neben dem Bett und strömte lautlos von Schütterung und Heimkehr über.
Die Augen der Frau sahen ihn lange friedvoll an. Erst allmählich wurden sie unruhig. Die Stirn begann zu zucken, und die Lippen bewegten sich. Dann flackerte es wie Schrecken in ihnen auf. Die Hand, die reglos auf der Decke lag, hob sich, als wollte sie sich vergewissern und berühren, was die Augen sahen.
»Ich bin es, Marie«, sagte Steiner.
Die Frau versuchte den Kopf zu heben. Ihre Augen irrten über sein Gesicht, das dicht vor ihr war.
»Sei ruhig, Marie, ich bin es«, sagte Steiner.»Ich bin gekommen.«
»Josef…«, flüsterte die Frau.
Steiner mußte den Kopf senken. Das Wasser schoß ihm in die Augen. Er biß sich auf die Lippen und schluckte.»Ich bin es, Marie. Ich bin zurückgekommen, zu dir.«
»Wenn sie dich finden…«, flüsterte die Frau.
»Sie finden mich nicht. Sie können mich nicht finden. Ich kann hierbleiben. Ich bleibe bei dir.«
»Faß mich an, Josef – ich muß fühlen, daß du da bist. Gesehen habe ich dich oft…«
Er nahm ihre leichte Hand mit den blauen Adern in seine Hände und küßte sie. Dann beugte er sich über sie und legte seine Lippen auf ihren müden und schon fernen Mund. Als er sich aufrichtete, standen ihre Augen voll Tränen. Sie schüttelte sanft das Gesicht, und die Tropfen fielen wie Regen herunter.
»Ich wußte, daß du nicht kommen konntest. Aber ich habe immer auf dich gewartet…«