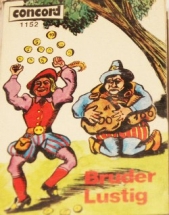Im Westen nichts Neues

Im Westen nichts Neues читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Das ist gut, und ich liebe es. Aber mit den Leuten kann ich nicht fertig werden. Die einzige, die nicht fragt, ist meine Mutter. Doch schon mit meinem Vater ist es anders. Er möchte, daß ich etwas erzähle von draußen, er hat Wünsche, die ich rührend und dumm finde, zu ihm schon habe ich kein rechtes Verhältnis mehr. Am liebsten möchte er immerfort etwas hören. Ich begreife, daß er nicht weiß, daß so etwas nicht erzählt werden kann, und ich möchte ihm auch gern den Gefallen tun; aber es ist eine Gefahr für mich, wenn ich diese Dinge in Worte bringe, ich habe Scheu, daß sie dann riesenhaft werden und sich nicht mehr bewältigen lassen. Wo blieben wir, wenn uns alles ganz klar würde, was da draußen vorgeht.
So beschränke ich mich darauf, ihm einige lustige Sachen zu erzählen. Er aber fragt mich, ob ich auch einen Nahkampf mitgemacht hätte. Ich sage nein und stehe auf, um auszugehen.
Doch das bessert nichts. Nachdem ich mich auf der Straße ein paarmal erschreckt habe, weil das Quietschen der Straßenbahnen sich wie heranheulende Granaten anhört, klopft mir jemand auf die Schulter. Es ist mein Deutschlehrer, der mich mit den üblichen Fragen überfällt.»Na, wie steht es draußen. Furchtbar, furchtbar, nicht wahr? Ja, es ist schrecklich, aber wir müssen eben durchhalten. Und schließlich, draußen habt ihr doch wenigstens gute Verpflegung, wie ich gehört habe, Sie sehen gut aus, Paul, kräftig. Hier ist das natürlich schlechter, ganz natürlich, ist ja auch selbstverständlich, das Beste immer für unsere Soldaten!«Er schleppt mich zu einem Stammtisch mit. Ich werde großartig empfangen, ein Direktor gibt mir die Hand und sagt:»So, Sie kommen von der Front? Wie ist denn der Geist dort? Vorzüglich, vorzüglich, was?«
Ich erkläre, daß jeder gern nach Hause möchte.
Er lacht dröhnend:»Das glaube ich! Aber erst müßt ihr den Franzmann verkloppen! Rauchen Sie? Hier, stecken Sie sich mal eine an. Ober, bringen Sie unserm jungen Krieger auch ein Bier.«
Leider habe ich die Zigarre genommen, deshalb muß ich bleiben. Alle triefen nur so von Wohlwollen, dagegen ist nichts einzuwenden. Trotzdem bin ich ärgerlich und qualme, so schnell ich kann. Um wenigstens etwas zu tun, stürze ich das Glas Bier in einem Zug hinunter. Sofort wird mir ein zweites bestellt; die Leute wissen, was sie einem Soldaten schuldig sind. Sie disputieren darüber, was wir annektieren sollen. Der Direktor mit der eisernen Uhrkette will am meisten haben: ganz Belgien, die Kohlengebiete Frankreichs und große Stücke von Rußland. Er gibt genaue Gründe an, weshalb wir das haben müssen, und ist unbeugsam, bis die andern schließlich nachgeben. Dann beginnt er zu erläutern, wo in Frankreich der Durchbruch einsetzen müsse, und wendet sich zwischendurch zu mir:»Nun macht mal ein bißchen vorwärts da draußen mit eurem ewigen Stellungskrieg. Schmeißt die Kerle ‘raus, dann gibt es auch Frieden.«-Ich antworte, daß nach unserer Meinung ein Durchbruch unmöglich sei. Die drüben hätten zuviel Reserven. Außerdem wäre der Krieg doch anders, als man sich das so denke.
Er wehrt überlegen ab und beweist mir, daß ich davon nichts verstehe.»Gewiß, der einzelne«, sagt er,»aber es kommt doch auf das Gesamte an. Und das können Sie nicht so beurteilen. Sie sehen nur Ihren kleinen Abschnitt und haben deshalb keine Übersicht. Sie tun Ihre Pflicht, Sie setzen Ihr Leben ein, das ist höchster Ehren wert – jeder von euch müßte das Eiserne Kreuz haben -, aber vor allem muß die gegnerische Front in Flandern durchbrochen und dann von oben aufgerollt werden.«
Er schnauft und wischt sich den Bart.»Völlig aufgerollt muß sie werden, von oben herunter. Und dann auf Paris.«Ich möchte wissen, wie er sich das vorstellt, und gieße das dritte Bier in mich hinein. Sofort läßt er ein neues bringen. Aber ich breche auf. Er schiebt mir noch einige Zigarren in die Tasche und entläßt mich mit einem freundschaftlichen Klaps.»Alles Gute! Hoffentlich hören wir nun bald etwas Ordentliches von euch.«
Ich habe mir den Urlaub anders vorgestellt. Vor einem Jahr war er auch anders. Ich bin es wohl, der sich inzwischen geändert hat. Zwischen heute und damals liegt eine Kluft. Damals kannte ich den Krieg noch nicht, wir hatten in ruhigeren Abschnitten gelegen. Heute merke ich, daß ich, ohne es zu wissen, zermürbter geworden bin. Ich finde mich hier nicht mehr zurecht, es ist eine fremde Welt. Die einen fragen, die andern fragen nicht, und man sieht ihnen an, daß sie stolz darauf sind; oft sagen sie es sogar noch mit dieser Miene des Verstehens, daß man darüber nicht reden könne. Sie bilden sich etwas darauf ein.
Am liebsten bin ich allein, da stört mich keiner. Denn alle kommen stets auf dasselbe zurück, wie schlecht es geht und wie gut es geht, der eine findet es so, der andere so, – immer sind sie auch rasch bei den Dingen, die ihr Dasein darstellen. Ich habe früher sicher genauso gelebt, aber ich finde jetzt keinen Anschluß mehr daran.
Sie reden mir zuviel. Sie haben Sorgen, Ziele, Wünsche, die ich nicht so auffassen kann wie sie. Manchmal sitze ich mit einem von ihnen in dem kleinen Wirtsgarten und versuche, ihm klarzumachen, daß dies eigentlich schon alles ist: so still zu sitzen. Sie verstehen das natürlich, geben es zu, finden es auch, aber nur mit Worten, nur mit Worten, das ist es ja – sie empfinden es, aber stets nur halb, ihr anderes Wesen ist bei anderen Dingen, sie sind so verteilt, keiner empfindet es mit seinem ganzen Leben; ich kann ja selbst auch nicht recht sagen, was ich meine.
Wenn ich sie so sehe, in ihren Zimmern, in ihren Büros, in ihren Berufen, dann zieht das mich unwiderstehlich an, ich möchte auch darin sein und den Krieg vergessen; aber es stößt mich auch gleich wieder ab, es ist so eng, wie kann das ein Leben ausfüllen, man sollte es zerschlagen, wie kann das alles so sein, während draußen jetzt die Splitter über die Trichter sausen und die Leuchtkugeln hochgehen, die Verwundeten auf Zeltbahnen zurückgeschleift werden und die Kameraden sich in die Gräben drücken! – Es sind andere Menschen hier, Menschen, die ich nicht richtig begreife, die ich beneide und verachte. Ich muß an Kat und Albert und Müller und Tjaden denken, was mögen sie tun? Sie sitzen vielleicht in der Kantine oder sie schwimmen – bald müssen sie wieder nach vorn.
In meinem Zimmer steht hinter dem Tisch ein braunes Ledersofa. Ich setze mich hinein.
An den Wänden sind viele Bilder mit Reißzwecken festgemacht, die ich früher aus Zeitschriften geschnitten habe. Postkarten und Zeichnungen dazwischen, die mir gefallen haben. In der Ecke steht ein kleiner eiserner Ofen. An der Wand gegenüber das Regal mit meinen Büchern.
In diesem Zimmer habe ich gelebt, bevor ich Soldat wurde. Die Bücher habe ich nach und nach gekauft von dem Geld, das ich mit Stundengeben verdiente. Viele davon antiquarisch, alle Klassiker zum Beispiel, ein Band kostete eine Mark und zwanzig Pfennig, in steifem, blauem Leinen. Ich habe sie vollständig gekauft, denn ich war gründlich, bei ausgewählten Werken traute ich den Herausgebern nicht, ob sie auch das Beste genommen hatten. Deshalb kaufte ich mir»Sämtliche Werke«. Gelesen habe ich sie mit ehrlichem Eifer, aber die meisten sagten mir nicht recht zu. Um so mehr hielt ich von den anderen Büchern, den moderneren, die natürlich auch viel teurer waren. Einige davon habe ich nicht ganz ehrlich erworben, ich habe sie ausgeliehen und nicht zurückgegeben, weil ich mich von ihnen nicht trennen mochte.
Ein Fach des Regals ist mit Schulbüchern gefüllt. Sie sind wenig geschont und stark zerlesen, Seiten sind herausgerissen, man weiß ja wofür. Und unten sind Hefte, Papier und Briefe hingepackt, Zeichnungen und Versuche.
Ich will mich hineindenken in die Zeit damals. Sie ist ja noch im Zimmer, ich fühle es sofort, die Wände haben sie bewahrt. Meine Hände liegen auf der Sofalehne; jetzt mache ich es mir bequem und ziehe auch die Beine hoch, so sitze ich gemütlich in der Ecke, in den Armen des Sofas. Das kleine Fenster ist geöffnet, es zeigt das vertraute Bild der Straße mit dem ragenden Kirchturm am Ende. Ein paar Blumen stehen auf dem Tisch. Federhalter, Bleistifte, eine Muschel als Briefbeschwerer, das Tintenfaß – hier ist nichts verändert.