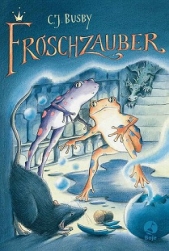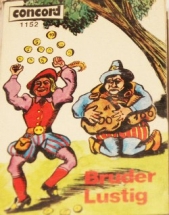Peter Camenzind

Peter Camenzind читать книгу онлайн
»Im Anfang war der Mythus. Wie der gro?e Gott in den Seelen der Inder, Griechen und Germanen dichtete und nach Ausdruck rang, so dichtet er in jedes Kindes Seele t?glich wieder.« Mit diesen S?tzen beginnt die erste Erz?hlung Hermann Hesses (1877-1962), die 1904 im S. Fischer Verlag erschien und ihren Autor mit einem Schlag ber?hmt machte. Der in unmittelbarer Nachfolge von Gottfried Kellers Gr?nem Heinrich stehende »Erziehungsroman« hat mit seinen erfrischenden, allem Pathetischen abholden Naturschilderungen bis heute nichts an Charme und Farbe verloren. Hesse selbst hat den dezidierten Individualismus Camenzinds als den »Anfang des roten Fadens« bezeichnet, der sein ganzes Werk durchzieht.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
6
Viel schlimmer war mein anderes Laster. Ich hatte wenig Freude an den Menschen, lebte als Einsiedler und war gegen menschliche Dinge stets mit Spott und Verachtung zur Hand.
Im Beginn meines neuen Lebens dachte ich daran noch gar nicht. Ich fand es richtig, die Menschen einander zu überlassen und meine Zärtlichkeit, Hingabe und Teilnahme allein dem stummen Leben der Natur zu schenken. Auch erfüllte diese mich im Anfang ganz.
Nachts, wenn ich zu Bett gehen wollte, fiel mir etwa plötzlich ein Hügel, ein Waldrand, ein einzelner Lieblingsbaum ein, den ich lange nicht mehr besucht hatte. Nun stand er in der Nacht im Wind, träumte, schlummerte vielleicht, stöhnte und regte die Zweige. Wie mochte er aussehen? Und ich verließ das Haus, suсhte ihn auf und sah seine undeutliche Gestalt im Finstern stehen, betrachtete ihn mit erstaunter Zärtlichkeit und trug sein dämmerndes Bild in mir davon.
Ihr lacht darüber. Vielleicht war diese Liebe verirrt, doch nicht vergeudet. Aber wie sollte ich von hier den Weg finden, der zur Menschenliebe führte?
Nun, wo ein Anfang gemacht ist, kommt immer das Beste von selber nach. Immer näher und möglicher schwebte mir die Idee meiner großen Dichtung vor. Und wenn mein Liebhaben mich dahin bringen würde, einmal als Dichter die Sprache der Wälder und Ströme zu reden, für wen geschähe das dann? Nicht nur für meine Lieblinge, sondern doch vor allem für die Menschen, denen ich ein Führer und ein Lehrer der Liebe sein wollte. Und gegen diese Menschen war ich rauh, spöttisch und lieblos. Ich empfand den Zwiespalt und die Nötigung, das herbe Fremdsein zu bekämpfen und auch den Menschen Brüderlichkeit zu zeigen. Und das war schwer, denn Vereinsamung und Schicksale hatten mich gerade auf diesem Punkt hart und böse gemacht. Es genügte nicht, daß ich daheim und im Wirtshaus mich mühte, weniger herb zu sein, und daß ich unterwegs einem Begegnenden freundlich zunickte, übrigens sah ich schon hierbei, wie gründlich ich mir das Verhältnis zu den Leuten versalzen hatte, denn man kam meinen Freundlichkeitsversuchen mißtrauisch und kühl entgegen oder nahm sie für Hohn auf. Das Schlimmste war, daß ich das Haus jenes Gelehrten, das einzige meiner Bekanntschaft, fast ein Jahr lang gemieden hatte, und ich sah ein, daß ich vor allem dort wieder anklopfen und mir irgendeinen Weg in die hiesige Art von Geselligkeit suchen müsse.
Nun, hier half mir meine eigene verhöhnte Menschlichkeit erklecklich. Kaum hatte ich wieder an jenes Haus gedacht, so sah ich auch im Geist Elisabeth, schön, wie sie vor Segantinis Wolke gewesen war, und merkte plötzlich, wie sehr sie an meiner Sehnsucht und Schwermut teilhatte. Und es geschah, daß ich zum erstenmal ernstlich daran dachte, ein Weib zu freien. Bisher war ich von meiner völligen Unfähigkeit zur Ehe so überzeugt gewesen, daß ich mich darein mit bissiger Ironie ergeben hatte. Ich war Dichter, Wanderer, Trinker, Einspänner! Jetzt glaubte ich mein Schicksal zu erkennen, das mir in der Möglichkeit einer Liebesehe die Brücke zur Menschenwelt schlagen wollte. Alles sah so verlockend und sicher aus! Daß Elisabeth mir Teilnahme schenkte, hatte ich gespürt und gesehen; auch daß sie ein empfängliches und edles Wesen besaß. Ich dachte daran, wie bei der Plauderei über San Clemente und dann vor dem Segantini ihre Schönheit lebendig geworden war. Ich aber hatte seit Jahren aus Kunst und Natur einen reichen inneren Besitz gesammelt; sie würde von mir das überall schlummernde Schöne sehen lernen, und ich würde sie so mit Schönem und Wahrem umgeben, daß ihr Gesicht und ihre Seele alle Trübungen vergäße und sich zur Blüte ihrer Fähigkeiten entfalten könnte. Seltsamerweise empfand ich das Komische meiner plötzlichen Verwandlung gar nicht. Ich Einsamer und Sonderling war über Nacht ein verliebter Fant geworden, der von Eheglück und von der Einrichtung eines eigenen Hauswesens träumt.
Eiligst suchte ich denn das gastliche Haus auf und ward mit freundlichen Vorwürfen empfangen. Ich ging mehrmals hin, und nach einigen Besuchen traf ich Elisabeth dort wieder. Oh, sie war schön! Sie sah aus, wie ich sie mir als meine Geliebte vorgestellt hatte: schön und glücklich. Und ich genoß eine Stunde lang die frohe Schönheit ihrer Gegenwart. Sie begrüßte mich gütig, sogar herzlich und mit einer vertrauten Freundschaftlichkeit, die mich glücklich machte.
Erinnert ihr euch noch des Abends auf dem See, im Boot, des Abends mit den roten Papierlampen, mit der Musik, mit meiner im Keim erstickten Liebeserklärung? Es war die traurige und lächerliche Geschichte eines verliebten Knaben.
Lächerlicher – und trauriger ist die Geschichte des verliebten Mannes Peter Camenzind.
Ich erfuhr so beiläufig, Elisabeth sei seit kurzem Braut. Ich gratulierte ihr, ich machte die Bekanntschaft ihres Verlobten, der sie abzuholen kam, und ich gratulierte auch ihm. Den ganzen Abend lag ein wohlwollendes Gönnerlächeln auf meinem Gesicht, mir selber lästig, wie eine Maske. Nachher lief ich weder in den Wald noch ins Wirtshaus, sondern saß auf meinem Bett, sah der Lampe zu, bis sie stank und. erlosch, erstaunt und verdonnert, bis endlich mein Bewußtsein wieder erwachte. Da breiteten noch einmal Schmerz und Verzweiflung ihre schwarzen Flügel über mich, daß ich klein und schwach und zerbrochen lag, und daß ich schluchzte wie ein Knabe.
Darauf packte ich meinen Rucksack, ging morgens zur Bahn und reiste nach Haus. Ich hatte Sehnsucht, wieder am Sennalpstock zu klettern, an meine Kinderzeit zu denken und nachzusehen, ob mein Vater noch lebe.
Wir waren uns fremd geworden. Der Vater sah völlig grau, ein wenig gebückt und ein wenig unscheinbar aus. Er behandelte mich sanft und mit Scheu, fragte nach nichts, wollte mir sein Bett abtreten und schien durch meinen Besuch nicht weniger in Verlegenheit gebracht, als überrascht zu sein. Er hatte das Häuschen noch, die Matten und das Vieh aber verkauft, bezog einen kleinen Zins und tat hier und dort ein wenig leichte Arbeit.
Als er mich allein ließ, trat ich an die Stelle, wo früher meiner Mutter Bett gestanden hatte, und das Vergangene lief wie ein breiter, ruhiger Strom an mir vorbei. Ich war kein Jüngling mehr und dachte daran, wie schnell die Jahre weitergehen würden, dann wäre auch ich ein gebücktes und graues Männlein und legte mich zum bittern Sterben hin. In der fast unveränderten, ärmlichen, alten Stube, wo ich klein gewesen war, wo ich Latein gelernt und den Tod der Mutter gesehen hatte, hatten diese Gedanken eine ruhebringende Natürlichkeit. Mit Dank erinnerte ich mich an allen Reichtum meiner Jugend, dabei fiel der Vers des Lorenzo Medici mir ein, den ich in Florenz gelernt hatte:
Und zugleich wunderte ich mich, Erinnerungen aus Italien und aus der Geschichte und aus dem weiten Reich des Geistes in diese alte heimatliche Stube zu tragen.
Darauf gab ich meinem Vater etwas Geld. Am Abend gingen wir ins Wirtshaus, und dort war alles wie damals, nur daß ich jetzt den Wein bezahlte und daß der Vater, als er vom Sternwein und Champagner sprach, sich auf mich berief und daß ich jetzt mehr als der Alte vertragen konnte. Ich fragte nach dem greisen Bäuerlein, dem ich damals den Wein über seinen Kahlkopf gegossen hatte. Er war ein Witzbold und Kniffgenie gewesen, aber nun war er längst tot, und über seine Schnurren begann Gras zu wachsen. Ich trank Waadtländer, hörte den Gesprächen zu, erzählte ein wenig, und da ich mit dem Vater durch den Mondschein nach Hause ging und er im Rausche weiterredete und gestikulierte, war mir so sonderbar verzaubert zumute wie noch nie. Fortwährend umgaben mich die Bilder der früheren Zeit, Onkel Konrad, Rösi Girtanner, die Mutter, Richard und die Aglietti, und ich sah sie an wie ein schönes Bilderbuch, bei dem man sich wundert, wie schön und wohlbeschaffen alle Dinge darin aussehen, die in der Wirklichkeit nicht halb so köstlich sind. Wie war das alles an mir vorbeigerauscht, vergangen, fast vergessen, und stand nun doch klar und reinlich in mir aufgezeichnet: ein halbes Leben, ohne meinen Willen vom Gedächtnis aufbewahrt.
Erst als wir nach Hause kamen und als mein Vater spät verstummte und entschlief, dachte ich wieder an Elisabeth. Noch gestern hatte sie mich begrüßt, hatte ich sie bewundert und hatte ihrem Bräutigam Glück gewünscht. Es schien mir eine lange Zeit seither vergangen zu sein. Aber der Schmerz erwachte, vermischte sich mit der Flut der aufgestörten Erinnerungen und rüttelte an meinem selbstsüchtigen und schlecht verwahrten Herzen wie der Föhn an einer zitternden und baufälligen Almhütte. Ich hielt es nicht im Hause aus. Ich stieg durchs niedere Fenster, ging durchs Gärtchen an den See, machte den verwahrlosten Weidling los und ruderte leise in die blasse Seenacht. Feierlich schwiegen umher die silbrig umdünsteten Berge, der fast völlige Mond hing in der bläulichen Nacht und ward beinahe von der Spitze des Schwarzenstocks erreicht. Es war so still, daß ich den fernen Sennalpstock-Wasserfall leise brausen hören konnte. Die Geister der Heimat und die Geister meiner Jugendzeit berührten mich mit ihren bleichen Flügeln, erfüllten meinen kleinen Nachen und deuteten flehentlich mit ausgestreckten Händen und schmerzlichen, unverständlichen Gebärden.
Was hatte nun mein Leben bedeutet, und wozu waren so viele Freuden und Schmerzen über mich hinweggegangen? Warum hatte ich Durst nach dem Wahren und Schönen gehabt, da ich heute noch ein Dürstender war? Warum hatte ich in Trotz und Tränen um jene begehrenswerten Frauen Liebe und Schmerzen gelitten – ich, der ich heute wieder das Haupt in Scham und Tränen um eine traurige Liebe neigte? Und warum hatte der unbegreifliche Gott mir das brennende Heimweh nach Liebe ins Herz getan, da er mir doch das Leben eines Einsamen und wenig Geliebten bestimmt hatte?
Das Wasser gurgelte dumpf am Bug und tröpfelte silbern von den Rudern, die Berge standen ringsum nahe und schweigend, über die Nebel der Schluchten wandelte das kühle Mondlicht. Und die Geister meiner Jugendzeit standen schweigsam um mich her und blickten mich aus tiefen Augen still und fragend an. Mir war, ich sähe unter ihnen auch die schöne Elisabeth, und sie hätte mich geliebt und sie wäre mein geworden, wenn ich zur rechten Zeit gekommen wäre.
Auch war mir, als wäre es am besten, ich sänke still in den bleichen See und es würde mir von niemand nachgefragt. Aber dennoch ruderte ich schneller, als ich merkte, daß der schlechte, alte Nachen Wasser zog. Mich fror plötzlich, und ich eilte, nach Haus und zu Bett zu kommen. Dort lag ich müd und wach und sann über mein Leben nach und suchte zu finden, was mir fehle und was mir nötig wäre, um glücklicher und echter zu leben und näher an das Herz des Daseins zu kommen.