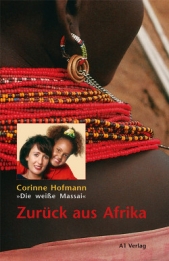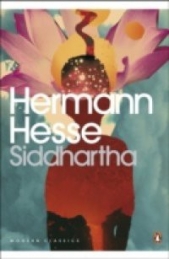Der Steppenwolf

Der Steppenwolf читать книгу онлайн
»Es war einmal einer namens Harry, genannt der Steppenwolf. Er ging auf zwei Beinen, trug Kleider und war ein Mensch, aber eigentlich war er doch eben ein Steppenwolf.« Der erstmals 1927 erschienene Roman Der Steppenwolf vor allem begr?ndet den Weltruf Hermann Hesses und ist dasjenige Buch, das die internationale Renaissance seines Autors in den sechziger und siebziger Jahren ausgel?st hat.
Der Steppenwolf ist die Geschichte von Harry Haller, der sich im Zustand v?lliger Entfremdung von seiner b?rgerlichen Welt »eine geniale, eine unbegrenzte furchtbare Leidensf?higkeit herangebildet« hat. Die innere Zerrissenheit Hallers spiegelt die Erscheinungen der modernen Massen- und Industriegesellschaft wider und reflektiert kultur- und zivilisationskritische Str?mungen des 20. Jahrhunderts.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
In der Tat war kein ernstes Wort mehr mit dem Mann zu reden, er tänzelte vergnügt und gelenkig auf und nieder und ließ die Primel aus seinem Stern bald wie eine Rakete herausschießen, bald klein werden und verschwinden. Während er mit seinen Tanzschritten und Figuren glänzte, mußte ich denken, daß dieser Mann es wenigstens nicht versäumt habe, tanzen zu lernen. Er konnte es wundervoll. Da fiel der Skorpion mir wieder ein, oder vielmehr Molly, und ich rief Goethe zu: »Sagen Sie, ist Molly nicht da?«
Goethe lachte laut. Er ging zu seinem Tisch, schloß ein Schubfach auf, nahm eine kostbare, lederne oder samtene Dose heraus, öffnete sie und hielt sie mir unter die Augen. Da lag klein, tadellos und schimmernd ein winziges Frauenbein auf dem dunklen Samt, ein entzückendes Bein, im Knie ein wenig gebogen, der Fuß nach unten gestreckt, in die zierlichsten Zehen spitz auslaufend. Ich streckte die Hand aus und wollte das kleine Bein an mich nehmen, das mich ganz verliebt machte, aber sowie ich mit zwei Fingern zugreifen wollte, schien das Spielzeug sich mit einem winzigen Zuck zu bewegen, und es kam mir plötzlich der Verdacht, dies könnte der Skorpion sein. Goethe schien das zu begreifen, schien sogar gerade das gewollt und bezweckt zu haben, diese tiefe Verlegenheit, diesen zuckenden Zwiespalt von Begehren und Angst. Er hielt mir das reizende Skorpiönchen ganz nahe vors Gesicht, sah mich danach verlangen, sah mich davor zurückschaudern, und dies schien ihm ein großes Vergnügen zu machen. Während er mich mit dem holden gefährlichen Ding neckte, war er wieder ganz alt geworden, uralt, tausend Jahre alt; mit schneeweißem Haar, und sein welkes Greisengesicht lachte still und lautlos, lachte heftig in sich hinein mit einem abgründigen Greisenhumor.
Als ich erwachte, hatte ich den Traum vergessen, erst später fiel er mir wieder ein. Ich hatte wohl gegen eine Stunde geschlafen, mitten in Musik und Getriebe, am Wirtshaustisch, nie hätte ich das für möglich gehalten. Das liebe Mädchen stand vor mir, eine Hand auf meiner Schulter.
»Gib mir zwei oder drei Mark«, sagte sie, »ich habe drüben etwas verzehrt.«
Ich gab ihr meinen Geldbeutel, sie ging damit und kam bald wieder.
»So, jetzt kann ich noch ein kleines Weilchen bei dir sitzen, dann muß ich gehen, ich habe eine Verabredung.«
Ich erschrak. »Mit wem denn?« fragte ich schnell.
»Mit einem Herrn, kleiner Harry. Er hat mich in die Odeon-Bar eingeladen.«
»Oh, ich dachte, du würdest mich nicht allein lassen.«
»Dann hättest eben du mich einladen müssen. Es ist dir einer zuvorgekommen. Nun, du sparst hübsch Geld dabei. Kennst du das Odeon? Nach Mitternacht nur Champagner. Klubsessel, Negerkapelle, sehr fein.«
Dies alles hatte ich nicht bedacht.
»Ach«, sagte ich bittend, »laß dich doch von mir einladen! Ich hielt das für selbstverständlich, wir sind doch Freunde geworden. Laß dich einladen, wohin du willst, ich bitte dich.«
»Das ist nett von dir. Aber schau, ein Wort ist ein Wort, ich habe angenommen, und ich werde hingehen. Gib dir keine Mühe mehr! Komm, nimm noch einen Schluck, wir haben ja noch Wein in der Flasche. Den trinkst du aus und gehst dann hübsch nach Hause und schläfst. Versprich mir's.«
»Nein, du, nach Hause kann ich nicht gehen.«
»Ach du, mit deinen Geschichten! Bist du noch immer nicht mit dem Goethe fertig?« (In diesem Augenblick fiel mir der Goethetraum wieder ein.) »Aber wenn du wirklich nicht heimgehen kannst, dann bleib hier im Haus, es sind Fremdenzimmer da. Soll ich dir eins besorgen?«
Ich war damit zufrieden und fragte, wo ich sie wiedersehen könne. Wo sie denn wohne? Das sagte sie mir nicht. Ich solle nur ein wenig suchen, dann fände ich sie schon.
»Darf ich dich nicht einladen?«
»Wohin?«
»Wohin du magst und wann du magst.«
»Gut. Am Dienstag zum Abendessen im Alten Franziskaner, im ersten Stock. Auf Wiedersehen!«
Sie gab mir die Hand, und erst jetzt fiel diese Hand mir auf, eine Hand, die ganz zu ihrer Stimme paßte, schön und voll, klug und gütig. Sie lachte spöttisch, als ich ihr die Hand küßte.
Und im letzten Augenblick wandte sie sich nochmals zu mir um und sagte: »Ich will dir noch etwas sagen, wegen des Goethe. Schau, so, wie es dir mit dem Goethe gegangen ist, daß du das Bild von ihm nicht vertragen konntest, so geht es mir manchmal mit den Heiligen.«
»Den Heiligen? Bist du so fromm?«
»Nein, ich bin nicht fromm, leider, aber ich bin es einmal gewesen und werde es einmal wieder sein. Man hat ja keine Zeit zum Frommsein.«
»Keine Zeit? Braucht man denn Zeit dazu?«
»O ja. Zum Frommsein braucht man Zeit, man braucht sogar noch mehr: Unabhängigkeit von der Zeit! Du kannst nicht ernstlich fromm sein und zugleich in der Wirklichkeit leben und sie auch noch ernst nehmen: die Zeit, das Geld, die Odeon-Bar und all das.«
»Ich verstehe. Aber wie ist das mit den Heiligen?«
»Ja, da gibt es manche Heilige, die habe ich besonders gern: den Stefan, den heiligen Franz und andere. Von ihnen sehe ich nun manchmal Bilder und auch vom Heiland und der Muttergottes, solche verlogene, verfälschte, verdummte Bilder, und die kann ich gerade so wenig ausstehen wie du jenes Goethebild. Wenn ich so einen süßen dummen Heiland oder heiligen Franz sehe und sehe, wie andere diese Bilder schön und erbaulich finden, dann spüre ich es wie eine Beleidigung des richtigen Heilands und denke: ach, wozu hat er gelebt und furchtbar gelitten, wenn den Leuten schon so ein dummes Bild von ihm genügt! Aber ich weiß trotzdem, daß auch mein Heiland- oder Franzbild bloß ein Menschenbild ist und an das Urbild nicht hinreicht, daß dem Heiland selbst mein inneres Heilandbild gerade so dumm und unzulänglich vorkommen würde wie mir jene süßlichen Nachbilder. Ich sage dir das nicht, um dir in deiner Verstimmung und Wut gegen das Goethebild recht zu geben, nein, du bist da im Unrecht. Ich sage es bloß, um dir zu zeigen, daß ich dich verstehen kann. Ihr Gelehrte und Künstler habt ja allerlei aparte Sachen in euren Köpfen, aber ihr seid Menschen wie andre, und auch wir andern haben unsre Träume und Spiele im Kopf. Ich habe nämlich gemerkt, gelehrter Herr, daß du ein bißchen in Verlegenheit kamst, wie du mir deine Goethegeschichte erzählen solltest – du mußtest dich anstrengen, um deine idealen Sachen so einem einfachen Mädchen verständlich zu machen. Nun, und da möchte ich dir doch zeigen, daß du dich nicht so anzustrengen brauchst. Ich verstehe dich schon. So, und jetzt Schluß! Du gehörst ins Bett.«
Sie ging, und mich führte ein greiser Hausdiener zwei Treppen hinauf, vielmehr, erst fragte er nach meinem Gepäck, und als er hörte, es sei keines da, mußte ich das, was er »Schlafgeld« nannte, vorausbezahlen. Dann brachte er mich, durch ein altes finstres Treppenhaus, in eine Kammer hinauf und ließ mich allein. Da stand ein dürres Holzbett, sehr kurz und hart, und an der Wand hing ein Säbel und ein farbiges Bildnis von Garibaldi, auch ein verwelkter Kranz von einer Vereinsfeier. Für ein Nachthemd hätte ich viel gegeben. Wenigstens war Wasser und ein kleines Handtuch da, ich konnte mich waschen, dann legte ich mich in den Kleidern aufs Bett, ließ das Licht brennen und hatte Zeit zum Nachdenken. Also mit Goethe war ich jetzt in Ordnung. Herrlich, daß er im Traum zu mir gekommen war! Und dieses wunderbare Mädchen – wenn ich doch ihren Namen gewußt hätte! Plötzlich ein Mensch, ein lebendiger Mensch, der die trübe Glasglocke meiner Abgestorbenheit zerschlug und mir die Hand hinstreckte, eine gute, schöne, warme Hand! Plötzlich wieder Dinge, die mich etwas angingen, an die ich mit Freude, mit Sorge, mit Spannung denken konnte. Plötzlich eine Türe offen, durch die das Leben zu mir hereinkam! Ich konnte vielleicht wieder leben, ich konnte vielleicht wieder ein Mensch werden. Meine Seele, in der Kälte eingeschlafen und nahezu erfroren, atmete wieder, schlug schläfrig mit kleinen schwachen Flügeln. Goethe war bei mir gewesen. Ein Mädchen hatte mich essen, trinken, schlafen geheißen, hatte mir Freundliches erwiesen, hatte mich ausgelacht, hatte mich einen dummen kleinen Jungen genannt. Und sie hatte mir auch, die wunderbare Freundin, von den Heiligen erzählt und mir gezeigt, daß ich sogar in meinen wunderlichsten Verstiegenheiten gar nicht allein und unverstanden und eine krankhafte Ausnahme sei, daß ich Geschwister habe, daß man mich verstehe. Ob ich sie wiedersehen würde? Ja, gewiß, sie war zuverlässig. »Ein Wort ist ein Wort.«
Und schon schlief ich wieder, schlief vier, fünf Stunden. Es war zehn Uhr vorüber, als ich aufwachte, in zerknitterten Kleidern, zerschlagen, müde, die Erinnerung an irgend etwas Gräßliches von gestern im Kopf, aber lebendig, hoffnungsvoll, voll guter Gedanken. Bei der Heimkehr in meine Wohnung empfand ich nichts mehr von den Schrecken, die diese Heimkehr gestern für mich gehabt hatte.
Auf der Treppe, oberhalb der Araukarie, traf ich mit der »Tante« zusammen, meiner Vermieterin, die ich selten zu Gesicht bekam, deren freundliches Wesen mir aber sehr gefiel. Die Begegnung war mir nicht angenehm, ich war immerhin etwas verwahrlost und übernächtig, nicht gekämmt und nicht rasiert. Ich grüßte und wollte vorübergehen. Sonst respektierte sie mein Verlangen nach Alleinbleiben und Nichtbeachtetwerden stets, heut aber schien in der Tat zwischen mir und der Umwelt ein Schleier zerrissen, eine Schranke gefallen zu sein – sie lachte und blieb stehen.
»Sie haben gebummelt, Herr Haller, Sie waren ja heut nacht gar nicht im Bett. Sie werden schön müde sein.«
»Ja«, sagte ich und mußte auch lachen. »Es ging heut nacht etwas lebhaft zu, und weil ich den Stil Ihres Hauses nicht stören wollte, schlief ich in einem Hotel. Mein Respekt vor der Ruhe und Achtbarkeit Ihres Hauses ist groß, manchmal komme ich mir darin sehr wie ein Fremdkörper vor.«
»Spotten Sie nicht, Herr Haller!«
»Oh, ich spotte bloß über mich selber.«
»Eben das sollten Sie nicht tun. Sie sollen sich in meinem Haus nicht als ‚Fremdkörper' fühlen. Sie sollen leben, wie es Ihnen gefällt, und treiben, was Sie mögen. Ich habe schon manche sehr, sehr achtbare Mieter gehabt, Juwelen an Achtbarkeit, aber keiner war ruhiger und hat uns weniger gestört als Sie. Und jetzt – wollen Sie einen Tee haben?«
Ich widerstand nicht. In ihrem Salon mit den schönen Großväterbildern und Großvätermöbeln bekam ich Tee vorgesetzt, und wir schwatzten ein wenig, die freundliche Frau erfuhr, ohne eigentlich zu fragen, dies und jenes aus meinem Leben und meinen Gedanken und hörte zu mit der Mischung von Achtung und mütterlichem Nicht-ganz-ernst-Nehmen, welche kluge Frauen für die Verschrobenheiten der Männer haben. Es war auch von ihrem Neffen die Rede, und sie zeigte mir in einem Nebenzimmer dessen neueste Feierabendarbeit, einen Radioapparat. Da saß der fleißige junge Mensch an seinen Abenden und stocherte eine solche Maschine zusammen, hingerissen von der Idee der Drahtlosigkeit, anbetend auf frommen Knien vor dem Gott der Technik, welcher es fertiggebracht hat, nach Jahrtausenden Dinge zu entdecken und höchst unvollkommen darzustellen, welche jeder Denker schon immer gewußt und klüger benutzt hat. Wir sprachen darüber, denn die Tante neigte ein klein wenig zur Frömmigkeit, und religiöse Gespräche sind ihr nicht unlieb. Ich sagte ihr, die Allgegenwart aller Kräfte und Taten sei den alten Indern sehr wohl bekannt gewesen und die Technik habe lediglich ein kleines Stück dieser Tatsache dadurch ins allgemeine Bewußtsein gebracht, daß die dafür, nämlich für die Tonwellen, einen vorerst noch grauenhaft unvollkommenen Empfänger und Sender konstruiert habe. Die Hauptsache jener alten Erkenntnis, die Unwirklichkeit der Zeit, sei bisher von der Technik noch nicht bemerkt worden, schließlich werde aber natürlich auch sie »entdeckt« werden und den geschäftigen Ingenieuren in die Finger geraten. Man werde, vielleicht schon sehr bald, entdecken, daß nicht nur gegenwärtige, augenblickliche Bilder und Geschehnisse uns beständig umfluten, so, wie die Musik aus Paris und Berlin jetzt in Frankfurt oder Zürich hörbar gemacht wird, sondern daß alles je Geschehene ganz ebenso registriert und vorhanden sei und daß wir wohl eines Tages, mit oder ohne Draht, mit oder ohne störende Nebengeräusche, den König Salomo und den Walther von der Vogelweide werden sprechen hören. Und daß dies alles, ebenso wie heute die Anfänge des Radios, den Menschen nur dazu dienen werde, von sich und ihrem Ziele weg zu fliehen und sich mit einem immer dichteren Netz von Zerstreuung und nutzlosem Beschäftigtsein zu umgeben. Aber ich sagte alle diese mir geläufigen Dinge nicht mit dem gewohnten Ton von Erbitterung und Hohn gegen die Zeit und gegen die Technik, sondern scherzhaft und spielend, und die Tante lächelte, und wir saßen wohl eine Stunde beisammen, tranken Tee und waren zufrieden.