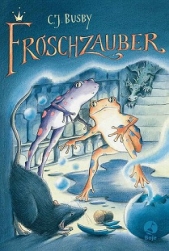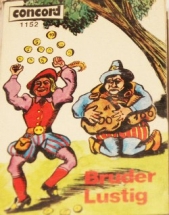Majestic – Die Saat des Todes

Majestic – Die Saat des Todes читать книгу онлайн
Eine fremdartige Macht droht die Menschheit zu vernichten.
November 1963. Die Ermordung Kennedys ersch?ttert die Welt. Doch die Menschheit ahnt nicht, wie nah sie am Abgrund steht: Eine au?erirdische Macht hat sich der wichtigsten Entscheidungstr?ger in Washington bem?chtig und will die Weltherrschaft erringen. Der junge Regierungsmitarbeiter John Loengard wei? von der Gefahr, aber als er das ganze Ausma? der Verschw?rung begreift, ist es fast zu sp?t. Zusammen mit seiner Geliebten Kimberley mobilisiert er in letzter Sekunde Kr?fte, die denen seiner Gegner ebenb?rtig scheinen. Bis er auch in den Augen eines vertrauten Menschen die Saat des Todes entdeckt...
Das Buch
1947 in einer W?stengegend im Westen der USA: Alles, was in Regierung und Milit?r Rang und Namen hat, ist unter dem n?chtlichen Himmel versammelt – Truman, der junge George Bush und die Gener?le der US-Armee. Pl?tzlich landet ein Raumschiff von einem fremden Planeten, eine T?r ?ffnet sich, und die Menschheit hat zum ersten Mal Kontakt zu Au?erirdischen.
1963: Der Agent John Loengard und seine Freundin Kim wissen, dass die Aliens sich bereits Washingtons wichtigster Entscheidungstr?ger bem?chtigt haben. Die Wesen aus dem Weltraum wollen die Welt ins Chaos st?rzen und die Weltherrschaft ?bernehmen. John und Kim hatten einen Gespr?chstermin bei Pr?sident John F. Kennedy, um ihn vor der Verschw?rung zu warnen, doch dieser wurde kurz vor dem Treffen in Dallas ermordet. Sollte verhindert werden, dass er die Wahrheit ?ber die Au?erirdischen erf?hrt? Nur John und Kim k?nnen die Menschheit vor einer grausamen ?bernahme bewahren, doch sie wissen nicht, wem sie trauen k?nnen. Vielleicht sind alle, die ihnen Hilfe anbieten, bereits Agenten der Au?erirdischen?
Dieser Roman ist die Fortsetzung zu Dark Skies – Das R?tsel um Majestic 12 (01/10.860).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
»Es sieht so aus, als seien wir auf uns allein gestellt«, fuhr Marcel fort. »Kommen Sie.«
Die Entschlossenheit in seiner Stimme stand im krassen Gegensatz zu seinem harmlosen Erscheinungsbild, eine Tatsache, die er sich wahrscheinlich schon oft zu Nutze gemacht hatte, um einen Gegner zu überrumpeln. Mit einer entschlossenen Bewegung nahm er den Holzstuhl, auf dem er die Nacht verbracht hatte, holte aus und ließ ihn mit aller Kraft gegen die schwere Scheibe donnern. Das Glas knirschte protestierend, nahm den Treffer aber ohne den kleinsten Riss hin.
»Verdammt«, fluchte er und versuchte es noch einmal. Sein Schwung war diesmal so groß, dass ein Bein von dem einfachen braunen Holzstuhl abriss und zentimeternah an mir vorbeisauste. Doch die Scheibe hielt nach wie vor stand. Was ihn nicht daran hinderte, es ohne zu zögern nochmals zu versuchen. Er nahm den Stuhl mit beiden Händen über den Rücken und ließ ihn mit aller Kraft auf die Scheibe niedersausen. Und diese Taktik hatte Erfolg; die Scheibe reagierte auf den Stuhl wie eine dünne Eisschicht auf einen schweren Männerstiefel und dünne Risse bewegten sich von der Stelle weg, an der der Stuhl aufgeplatzt war. Mit zwei, drei weiteren Schlägen gelang es Marcel, die angeschlagene Scheibe endgültig zu zersplittern. Ein wahrer Scherbenregen brach in den Gang hinaus und stürzte glitzernd auf den mausgrauen Boden wie ein warmer Sonnenregen auf einen unbestellten Acker.
Triumphierend drehte er sich mit dem Stuhl in der Hand um, dem die rohe Gewalt übel mitgespielt hatte: Die beiden vorderen Beine waren abgebrochen, das hintere zersplittert. Die ganze Aktion hatte nur wenige Sekunden gedauert und mich mehr als überrascht; schließlich hatte ich angenommen, einem Mann wie Marcel gegenüber die Führung übernehmen zu müssen. Das sollte ein Mann ohne Rückgrat sein? Was auch immer mir Bach über diesen ehemaligen PR-Verantwortlichen hatte einreden wollen: Es passte überhaupt nicht zum Verhalten des zerbrechlich wirkenden, aber mehr als tatkräftigen Mannes.
Ich zögerte nicht länger, sondern war mit einem Satz auf dem Gang. Glassplitter knirschten unter meinen Schuhen und irgendetwas brannte auf meiner Wange; wahrscheinlich ein Glassplitter aus der nicht vollkommen zerstörten Scheibe, den ich mir bei meinem ungestümen Satz durch das Loch im Glas zugefügt hatte. Ich achtete nicht darauf, sondern hetzte mit Riesenschritten auf die zusammengekrümmte menschliche Gestalt zu, die Steel mit einem Gewehrschuss niedergestreckt hatte.
In diesem Moment flackerte das Licht, unmerklich fast und doch ungemein störend wie alles, was daran erinnerte, dass sich über uns Tonnen an Geröll und Erde auftürmten und ein Leben in dieser Anlage tief unter der Oberfläche nur möglich war, wenn die Technik einwandfrei funktionierte. Einen Herzschlag lang blieb ich mit geballten Fäusten auf dem Gang stehen und trotz der kühlen Luft in diesem Teil des Gebäudes, den die Lüftungsanlage gleichmäßig bis in den letzten Winkel verteilte, stand mir der Schweiß auf der Stirn.
Dann fiel das Licht endgültig aus. Einen Moment lang herrschte absolute Finsternis um uns herum. Es kam so überraschend, dass ich gar nichts in mir spürte außer der Verwunderung darüber, wie dunkel es in einem Gebäude unter der Erde sein konnte, in das kein Licht einer entfernten Straßenlaterne fiel, kein Sternenlicht und kein Mondschein für eine geringe Aufhellung sorgte, keine Lampe aus einem Nachbarhaus ihre warmgelben Finger in die Nacht hinausschickte. Bevor dieser Gedanke mir überhaupt bewusst durch den Kopf schießen konnte, flackerte schon wieder etwas auf, durchbrach pulsierender Lichtschein die Schwärze um mich herum und beraubte sie ihrer alles verschlingenden Kraft. Ein paar Sekunden flackerte es noch, dann wurde es wieder heller, wenn auch nicht mit der selbstverständlichen Leuchtkraft, die von den gleichmäßig angebrachten Neonröhren ausging. Es war die Notbeleuchtung, die zuverlässig in die Bresche gesprungen war und uns vor dem Schicksal bewahrte, uns wie lebendig begraben zu fühlen.
Und mich damit erbarmungslos mit der Realität konfrontierte.
Am Boden direkt vor mir lag die Wache und sie war zweifelsohne tot. Einen Bauchschuss aus nur wenigen Zentimeter Entfernung mit der großkalibrigen Waffe konnte wahrscheinlich nur ein von Ganglien zerfressener Mensch überleben; der Schuss musste dem Mann regelrecht die Eingeweide zerfetzt haben. Aber es war nicht an der Zeit, meinen Gefühlen nachzugeben. Ich bückte mich nach dem Schnellfeuergewehr, wobei ich nicht verhindern konnte, dass mein Blick die toten Augen des Soldaten trafen. Wenn überhaupt etwas in diesen Augen im Augenblick des Todes eingefroren war, dann nicht Schmerz, sondern grenzenlose Überraschung. Der Mann hatte keine Zeit gehabt, mit seinem Leben abzuschließen; ein weiteres Opfer, das Steel bedenkenlos ausgelöscht hatte, doch diesmal nicht in Bachs Auftrag, sondern ganz im Gegenteil, im Kampf gegen ihn.
Marcel war direkt neben mir stehen geblieben und in seinem Blick war eine Nachdenklichkeit, die ich nicht zu deuten vermochte. Es herrschte eine unangenehme Ruhe, selbst das immer währende Säuseln der Lüftungsanlage schien verstummt zu sein. »Hier«, sagte ich rau und warf Marcel das Gewehr zu. Er fing es mit einem schnellen, routinierten Griff auf.
Ich kniete neben dem toten Soldaten und öffnete mit einem entschlossenen Ruck seine Pistolentasche. Das kalte Metall der Waffe glitt in meine Hand, aber die beruhigende Wirkung blieb aus. Steel war nicht unsterblich, aber nach meinem Empfinden zu nahe dran an einem Zustand der Unbesiegbarkeit, als dass mir allein eine Pistole ein Gefühl der Sicherheit hätte geben können. Während ich mich wieder erhob, schob ich den Sicherungshebel der 38er zurück.
»Gehen wir«, sagte ich. Meine Schritte quietschten unangenehm laut auf dem grauen Kunststoffboden, als ich auf die Tür zuging, die zur Nottreppe führte. Es dauerte ein paar Sekunden, bevor ich begriff, dass mir Marcel nicht folgte. Ich drehte mich zu ihm um und blieb stehen. Er stand an der Tür, durch die der Soldat geflogen war, und starrte ins Innere des Raums, der nach meiner Erinnerung eines der vielen gesicherten Labors auf dieser Ebene beherbergte. Sein Gewehr hing kraftlos in seinem Arm und seine Körperhaltung verriet, dass für den Augenblick alles Kämpferische von ihm abgefallen war.
»Was für eine Scheiße«, murmelte er so leise, dass ich ihn kaum verstehen konnte. »Was für eine gottverdammte Scheiße.«
»Was ist?«, fragte ich besorgt.
Marcel schüttelte benommen den Kopf. »Unser Mann war nicht der Einzige«, sagte er dann kraftlos. »Steel hat ein regelrechtes Blutbad angerichtet.« Er deutete ins Innere des Raums. »Da liegen noch drei Agenten. Mein Gott, wie hat er das nur geschafft?«
Ehe ich ihn fragen konnte, was genau er damit meinte, war er schon in der Tür verschwunden. »Marcel!«, rief ich und konnte dabei nicht verhindern, dass meine Stimme abkippte. »Was soll der Quatsch?«
»Ich sehe nur nach, ob hier noch jemand lebt«, hörte ich seine Stimme dumpf aus dem Labor. Irgendwo hörte ich Schritte, aber ich wusste nicht, von wem sie stammten und wohin sie führten, ich wusste nur, dass Marcel in dem Labor verschwunden war, statt sich mit mir sofort und ohne weitere Verzögerung auf die Jagd nach Steel zu machen, den wir unter allen Umständen von dem abhalten mussten, was auch immer er vorhatte.
Die Schritte verstummten und dann klirrte etwas. Mein Herz klopfte wie rasend und meine rechte Hand umklammerte die Pistole so stark, das es mir selber wehtat. Ich versuchte mich zu beruhigen, redete mir ein, dass Marcel das einzig Richtige tat. Vielleicht konnte er noch jemanden retten. Aber mein Instinkt riet mir, auf dem Absatz kehrtzumachen und sofort von hier zu verschwinden.
Dann hörte ich ein entferntes Rascheln und plötzlich und ohne Vorwarnung leise Stimmen, die sich so selbstverständlich zu unterhalten schienen, als sei überhaupt nichts Besonderes vorgefallen. »Marcel!«, rief ich erneut. »Was, zum Teufel, geht da vor?«