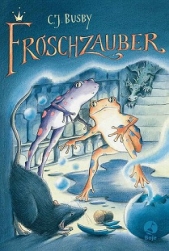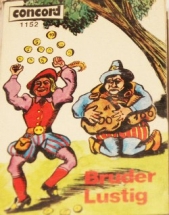Majestic – Die Saat des Todes

Majestic – Die Saat des Todes читать книгу онлайн
Eine fremdartige Macht droht die Menschheit zu vernichten.
November 1963. Die Ermordung Kennedys ersch?ttert die Welt. Doch die Menschheit ahnt nicht, wie nah sie am Abgrund steht: Eine au?erirdische Macht hat sich der wichtigsten Entscheidungstr?ger in Washington bem?chtig und will die Weltherrschaft erringen. Der junge Regierungsmitarbeiter John Loengard wei? von der Gefahr, aber als er das ganze Ausma? der Verschw?rung begreift, ist es fast zu sp?t. Zusammen mit seiner Geliebten Kimberley mobilisiert er in letzter Sekunde Kr?fte, die denen seiner Gegner ebenb?rtig scheinen. Bis er auch in den Augen eines vertrauten Menschen die Saat des Todes entdeckt...
Das Buch
1947 in einer W?stengegend im Westen der USA: Alles, was in Regierung und Milit?r Rang und Namen hat, ist unter dem n?chtlichen Himmel versammelt – Truman, der junge George Bush und die Gener?le der US-Armee. Pl?tzlich landet ein Raumschiff von einem fremden Planeten, eine T?r ?ffnet sich, und die Menschheit hat zum ersten Mal Kontakt zu Au?erirdischen.
1963: Der Agent John Loengard und seine Freundin Kim wissen, dass die Aliens sich bereits Washingtons wichtigster Entscheidungstr?ger bem?chtigt haben. Die Wesen aus dem Weltraum wollen die Welt ins Chaos st?rzen und die Weltherrschaft ?bernehmen. John und Kim hatten einen Gespr?chstermin bei Pr?sident John F. Kennedy, um ihn vor der Verschw?rung zu warnen, doch dieser wurde kurz vor dem Treffen in Dallas ermordet. Sollte verhindert werden, dass er die Wahrheit ?ber die Au?erirdischen erf?hrt? Nur John und Kim k?nnen die Menschheit vor einer grausamen ?bernahme bewahren, doch sie wissen nicht, wem sie trauen k?nnen. Vielleicht sind alle, die ihnen Hilfe anbieten, bereits Agenten der Au?erirdischen?
Dieser Roman ist die Fortsetzung zu Dark Skies – Das R?tsel um Majestic 12 (01/10.860).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ich rechnete damit, dass wir für den Weg zum Car Paradise gut zwanzig Minuten brauchen würden. Es wurde eine kleine Ewigkeit daraus. Der Dodge lief stur und unbeirrt durch den Regen, eher wie ein LKW als wie einer der relativ komfortablen Straßenkreuzer, die Anfang der 60er Jahre die Straßen zu dominieren begannen. Ein leichter Regen ließ die Fahrbahn hinter einem Vorhang glitzernder Tröpfchen verschwinden. Natürlich hatte dieses Prachtstück aus den frühen 40er Jahren keine Waschanlage für die Frontscheibe und so blieb mir nichts anderes übrig, als mit zugekniffenen Augen durch die zerkratzte Windschutzscheibe ins düstere Grau hinauszustarren und zu hoffen, dass ich trotz meiner Müdigkeit keine Brems– oder Ampellichter übersah.
»Es tropft«, sagte Kimberley, nachdem wir schon mindestens fünf Minuten wortlos durch die Nacht gefahren waren. »Das Dach ist undicht.«
»Damit werden wir wohl leben müssen«, antwortete ich müde. »Immerhin war es doch nett von Carl, dass er den Wagen aufgetankt und mit Zündschlüssel im Schloss in seiner Garage stehen hatte. Wir hätten ja wohl kaum per Anhalter fahren können.«
»Nein, aber wir hätten ein Taxi nehmen können«, sagte Kimberley. »Wir hätten uns doch etwas Geld von deinem Doktor ausleihen können...«
»Die Spur eines Taxis lässt sich leichter verfolgen als die eines Oldtimers«, sagte ich gereizt. Ich hatte jetzt absolut keine Lust auf eine Wir-hätten-doch-können-Diskussion. Und mir war auch nicht danach zu erklären, warum ich das ungefragte Ausleihen eines Autos in der jetzigen Situation für legitim hielt, nicht aber das Durchwühlen von Carls persönlichen Sachen auf der Suche nach ein paar Dollar. Dass Kimberley überhaupt auf eine solche Idee kam, beunruhigte mich. Es passte so gar nicht zu ihrem Charakter.
»Da vorne müssen wir, glaube ich, links«, unterbrach sie meine düsteren Gedanken. Sie hatte immer schon über einen guten Orientierungssinn verfügt und kannte sich in Washington fast besser aus als ich.
»Danke, ich kenne den Weg«, sagte ich schroff. Dabei stimmte das nicht ganz. Die Abzweigung hätte ich vermutlich übersehen. Denn in Gedanken war ich immer noch bei dem kurzen Telefonat mit Lucy, meiner Schwester, die ich aus einer Telefonzelle heraus nur drei Blocks von Hertzogs Haus entfernt angerufen hatte. Es war ein merkwürdiges Gespräch gewesen. Als meine Schwester begriffen hatte, wen sie da am Telefon hatte, war ihre an sich ruhige Stimme geradezu umgekippt. »John!«, hatte sie geschrien. »Was zur Hölle ist los? Wo bist du? Wie geht es dir? Was macht Kimberley?« Nachdem ich ihren Wortschwall einigermaßen hatte stoppen können, hatte ich alles versucht, um sie zu beruhigen und ihr gleichzeitig anzudeuten, dass wir in einigen Tagen Hilfe gebrauchen könnten. »Selbstverständlich. Was können wir tun?«, hatte sie gesagt und ich schäme mich nicht, dass meine Augen bei dieser Antwort feucht geworden waren. Ein Stück Kindheitsgeborgenheit schien in diesem Moment durch die Telefonleitung zu kriechen und die Erinnerung an wilde Tage stieg in mir hoch, an gemeinsam durchgestandene Jugendstreiche, an das Vertrauen zwischen uns vier Geschwistern, an dieses unendlich schöne Gefühl zu wissen, dass die anderen immer zu mir halten würden, egal, was geschah. Wir hatten uns vielleicht aus den Augen verloren, und doch war da noch immer dieses alte Gefühl der Verbundenheit, das uns durch unsere Kindheit getragen hatte – und letztlich auch das Gefühl, dass ich in meine Beziehung zu Kimberley mit hatte einbringen können.
Ich setzte den Blinker und bog vorsichtig in die Hauptstraße ein. Das Gespräch mit Lucy hat mir Mut gemacht und doch gleichzeitig verwirrt. Ich hatte ihr kurz und knapp erzählt, was wir vorhatten und dass ich mich nach unserer Stippvisite im Car Paradise wieder bei ihr melden würde. Sie hatte mir im Gegenzug berichtet, dass mein Bruder Ray nach Washington gefahren sei, um mir zu helfen. Das verstand ich nicht. Was konnte Ray dazu bewogen haben, sein alltägliches behütetes Leben aufzugeben, nur um aufs Geratewohl nach Washington zu kommen? Da musste mehr vorgefallen sein als nur eine Familiendiskussion, wie man einem Bruder helfen konnte.
Doch ich kam nicht dazu, den Gedankengang weiterzuverfolgen. Bei einem Blick in den Rückspiegel fiel mir ein grelles Scheinwerferpaar auf, das zuerst auf uns zuschoss und dann wieder zurückfiel. Ich verfluchte die Konstrukteure dieser alten Gurken, die den Wagen nur Rückfenster spendiert hatten, die kaum größer waren als der Sehschlitz eines Panzers. Ich konnte im Rückspiegel einfach nicht genug erkennen, um beurteilen zu können, ob wir verfolgt wurden oder nicht.
»Pass auf«, schrie Kimberley plötzlich. »Du rammst noch den Lastwagen.«
Sie hatte Recht. Ich trat auf die Bremse und der Wagen schlitterte rasiermesserscharf an einem alten, qualmenden Truck vorbei. Einen fürchterlichen Moment verlor ich die Kontrolle über den Wagen, kurbelte wie wild am Lenkrad. Doch dann fing sich der Dodge wieder und ich konnte ihn problemlos an dem Truck vorbeilenken. Als wir auf der Höhe des Führerhauses waren, drückte der Fahrer auf die Hupe. Das brutale Dröhnen ließ mich schmerzhaft zusammenzucken, aber das war ja wahrscheinlich genau das, was der Fahrer beabsichtigt hatte.
»Idiot«, murmelte ich. Dabei meinte ich aber mehr mich als den Truck-Fahrer. Denn ein rascher Blick in den Rückspiegel hatte mich überzeugt, dass außer dem Lastwagen im Augenblick niemand hinter uns war. Wegen eines Hirngespinsts hätte ich beinahe einen Unfall gebaut. Langsam begann ich eine Art Verfolgungswahn zu entwickeln, der letztlich genauso gefährlich sein konnte wie die Gefahr, in der ich und Kim tatsächlich schwebten.
Kimberley verzichtete darauf, mein ungeschicktes Fahrmanöver zu kommentieren. Das war auch besser so. Denn ich brauchte meine ganze Konzentration, um nicht von der Fahrbahn abzukommen. Die huschenden Lichtreflexe und das tiefe Brummen des Motors hatten etwas Einlullendes und ich musste mich mehr als einmal zusammenreißen, um nicht der Trägheit meiner Augenlider nachzugeben. Die Ganglien, Bach, die Ermordung Kennedys und auch dieser merkwürdig knappe Halbsatz Lucys über die kurz entschlossene Reise meines Bruders Ray nach Washington, bevor mein Kleingeld ausgegangen war und ich Genaueres erfahren konnte – all das schrumpfte zu einem unbedeutenden Etwas zusammen angesichts der Erschöpfung, die mich erbarmungslos darauf aufmerksam machte, dass ich am Rande meiner Kraft war.
Obwohl ich erst einmal im Car Paradise gewesen war und mich mehr im Halbschlaf als im Wachzustand befand, funktionierte mein Orientierungssinn erstaunlich gut. Mit geradezu traumwandlerischer Sicherheit steuerte ich durch die Straßen Washingtons, die heute weniger belebt waren als gewöhnlich. Das lag wahrscheinlich nicht nur an dem unangenehmen Nieselregen, sondern auch an der Tatsache, dass sich das wichtigste Machtzentrum der westlichen Welt seit der brutalen Ermordung Kennedys noch immer nicht von seinem Schock erholt hatte.
Schließlich erreichten wir die Seitenstraße, in der sich das große, aber heruntergekommene Gebrauchtwagengelände befand. Ein paar bunte Glühbirnenketten tauchten den Hof in einen undefinierbaren Lichterglanz, der vom mühsam aufpolierten Lack Dutzender Gebrauchtwagen zweifelhaften Zustands widergespiegelt wurde. Ein blinkender Lichtpfeil mit dem geschwungenen Schriftzug Car Paradise zeigte auf das lang gestreckte, flache Gebäude, das gleichzeitig als Werkstatt, Büro und Verkaufsraum diente. Das alles machte einen so tristen Eindruck, dass ich unter anderen Voraussetzungen nie meinen Fuß auf dieses Gelände gesetzt hätte. Doch so steuerte ich den Dodge in Richtung des blinkenden Lichtpfeils an der traurigen Parade der Rostlauben vorbei und hielt direkt neben der Eingangstür an.
»Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragte Kimberley besorgt.
»Aber ja«, antwortete ich mit einer Zuversicht in der Stimme, die ich so nicht empfand. »Hier habe ich mich vor ein paar Wochen mit Robert Kennedy getroffen. Und Nelson T. Bennet hat den Kontakt hergestellt. Wenn er hier ist, wird er uns auch weiterhelfen können.«