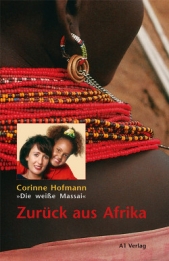Die weisse Massai
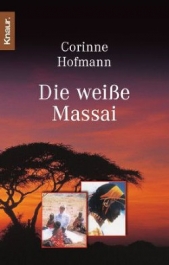
Die weisse Massai читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Aber es gibt auch Nachteile. Abends schwirren schrecklich viele Moskitos herum, und natürlich schlafen wir unter dem Moskitonetz. Es wird so schlimm, daß ich abends sogar noch eine Moskitokeule in der Manyatta abbrenne.
Nun sind zehn Tage seit dem großen Regen vergangen, und wir sind weiterhin durch die beiden mit Wasser gefüllten Flüsse von der Außenwelt getrennt. Obwohl man sie zu Fuß bereits überqueren kann, darf man mit dem Wagen nichts riskieren.
Giuliano hat mich eindringlich gewarnt. Es seien bereits einige Fahrzeuge im Fluß steckengeblieben, und man konnte zusehen, wie der Treibsand sie langsam verschlang.
Tage später wagen wir eine Fahrt nach Maralal. Wir nehmen den Umweg, weil im Wald die Straße glitschig und naß ist. Diesmal bekommen wir nicht gleich einen Lastwagen, sondern müssen vier Tage in Maralal herumhängen. Wir besuchen Sophia. Ihr geht es gut. Sie ist schon so dick geworden, daß sie sich kaum bücken kann. Von Jutta hat sie nichts mehr gehört.
Mein Mann und ich verbringen viel Zeit in der Touristen-Lodge. Jetzt ist es besonders faszinierend, das Wasserloch für die wilden Tiere zu beobachten. Wir haben ja Zeit. Am letzten Tag kaufen wir uns ein Bett mit Matratze, einen Tisch mit vier Stühlen und einen kleinen Schrank. Die Möbel sind nicht so schön wie die in Mombasa, dafür teurer. Der Chauffeur zeigt keine große Freude, als er diese Sachen auch noch abholen muß, aber schließlich bezahle ich ja den Laster. Wir fahren ihm hinterher und erreichen diesmal Barsaloi nach fast sechs Stunden problemlos, nicht einmal ein Reifenwechsel war nötig. Zuerst werden die Möbel im hinteren Teil aufgestellt, dann geht die übliche Abladerei los.
Auszug aus der Manyatta
Am nächsten Tag ziehen wir in den Shop. Es ist drückend heiß, die Blumen sind wieder verschwunden, die Ziegen haben ganze Arbeit geleistet. Ich rücke die Möbel hin und her, aber eine gemütliche Atmosphäre wie in der Manyatta will sich nicht einstel en. Aber ich verspreche mir wesentlich weniger Umstände und geregelte Mahlzeiten, was nun dringend nötig ist. Als der Shop geschlossen ist, geht mein Mann schnell nach Hause, um seine Tiere zu begrüßen. Ich koche einen guten Eintopf mit frischen Kartoffeln, Rüben und Kohl.
Die erste Nacht schlafen wir beide schlecht, obwohl wir bequem im Bett liegen.
Das Blechdach knackt dauernd, so daß wir keinen Schlaf finden. Um sieben Uhr morgens klopft jemand an die Tür. Lketinga geht nachschauen und findet einen Jungen vor, der Zucker haben will. Gutmütig gibt er ihm das halbe Kilo und schließt wieder zu. Für mich ist es nun einfach, meine Morgentoilette zu erledigen, da ich mich in einem Becken gut waschen kann. Das WC-Häuschen ist nur 50 Meter entfernt. Das Leben erscheint mir angenehmer, dafür weniger romantisch.
Zwischendurch, wenn Lketinga ebenfalls im Shop ist, kann ich mich kurz hinlegen.
Während des Kochens bin ich immer wieder vorne im Laden. Eine Woche lang geht alles wunderbar. Ich habe ein Mädchen, das für mich das Wasser bei der Mission abholt. Es kostet etwas, doch dafür brauche ich nicht mehr an den Fluß zu gehen.
Außerdem ist es klar und sauber. Bald hat es sich herumgesprochen, daß wir im Shop leben. Nun kommen pausenlos Kunden und betteln um Trinkwasser. In den Manyattas ist es Sitte, diesen Wunsch zu erfüllen. Doch mittags habe ich von meinen 20 Litern schon fast nichts mehr. Ständig hocken Krieger auf unserem Bett und warten auf Lketinga und somit auf Tee und Essen. Solange der Laden mit Lebensmitteln vol ist, kann er ja nicht sagen, wir hätten nichts.
Nach solchen Besuchen finde ich die Wohnung chaotisch vor. Verschmierte Töpfe oder abgenagte Knochen liegen überall verstreut herum. An den Wänden klebt brauner Schleim. Meine Wolldecke und die Matratze sind vol roter Ockerfarbe von der Bemalung der Krieger. Ich habe mehrere Auseinandersetzungen mit meinem Mann, da ich mir ausgenutzt vorkomme. Manchmal versteht er mich und schickt sie zu Mama nach Hause, ein andermal stellt er sich gegen mich und verschwindet mit ihnen. Auch für ihn ist diese Situation neu und schwer zu handhaben. Wir müssen einen Weg finden, das Gastrecht zu erfül en, ohne ausgenützt zu werden.
Mit der Frau des Veterinärs habe ich mich angefreundet und werde ab und zu bei ihnen zum Tee eingeladen. Ich versuche, ihr mein Problem zu schildern, und zu meinem Erstaunen versteht sie mich sofort. Sie sagt, das sei die Art der Manyatta-Leute, doch in der „town“ habe man dieses Gastrecht sehr eingeschränkt. Es gelte nur noch für Familienmitglieder und sehr gute Freunde, aber keinesfalls mehr für jeden, der des Weges kommt. Am Abend teile ich Lketinga mein Wissen mit, und er verspricht, es in Zukunft ebenfalls so zu handhaben.
In der näheren Umgebung finden in den kommenden Wochen mehrere Hochzeiten statt. Meistens sind es ältere Männer, die die dritte oder vierte Frau heiraten wol en.
Es sind immer junge Mädchen, denen man ihr Elend später oft an den Gesichtern ablesen kann. Es kommt nicht selten vor, daß der Altersunterschied dreißig oder mehr Jahre beträgt. Am glücklichsten sind jene Mädchen, die als erste Frau eines Kriegers geheiratet werden.
Unser Zucker nimmt rapide ab, da als Brautpreis unter anderem häufig 100 kg Zucker benötigt werden und für das Fest selbst zusätzlich mehrere Kilo. So kommt der Tag, an dem wir den Shop zwar vol Maismehl haben, aber keinen Zucker mehr.
Zwei Krieger, die in vier Tagen heiraten wollen, stehen ratlos im Laden. Auch bei den Somalis ist der Zucker längst ausgegangen. Schweren Herzens mache ich mich auf den Weg nach Maralal.
Der Veterinär begleitet mich, was mir sehr angenehm ist. Wir fahren wieder den Umweg. Er wil seinen Lohn abholen und mit mir wieder zurückfahren. Den Zucker habe ich schnel gekauft. Für Lketinga bringe ich das versprochene Miraa mit.
Der Veterinär läßt auf sich warten. Es ist fast vier Uhr, als er endlich erscheint. Er schlägt vor, den Urwaldweg zu fahren. Mir ist nicht wohl bei diesem Gedanken, denn ich habe die Straße seit dem großen Regen nicht mehr benutzt. Doch er meint, jetzt sei es auch dort trocken. Also fahren wir los. Häufig müssen wir größere Schlammpfützen durchqueren, doch im Vierrad ist das kein Problem. Am Todeshang sieht der Weg nun ganz anders aus. Das Wasser hat große Gräben herausgewaschen. Wir steigen oben aus und laufen die Strecke zu Fuß ab, um zu sehen, wo wir am besten durchkommen. Außer bei einem Riß, der quer durch die Straße geht und sicher 30 Zentimeter breit ist, sehe ich überal die Möglichkeit, mit etwas Glück auch diesen Abschnitt zu schaffen.
Wir wagen es. Ich fahre auf den erhöhten Ebenen und hoffe sehr, nicht in den Graben zu rutschen, denn dann würden wir im Schlamm stecken. Wir schaffen es und sind erleichtert. Bei den Felsen ist es wenigstens nicht rutschig. Der Wagen holpert ächzend über die Brocken. Das Gröbste liegt hinter uns, jetzt kommen noch zwanzig Meter Schotter.
Plötzlich scheppert etwas unter dem Wagen. Ich fahre weiter, doch dann halte ich an, weil das Geräusch lauter wird. Wir steigen aus. Von außen sieht man nichts. Ich schaue unter den Wagen und entdecke das Übel. Auf der einen Seite sind die Federn bis auf zwei Stück gebrochen, wir haben praktisch keine Federung mehr. Die einzelnen Teile schleifen am Boden und verursachen das Geräusch.
Schon wieder hänge ich mit diesem Vehikel fest! Ich bin wütend auf mich, daß ich mich zu dieser Straße habe überreden lassen. Der Veterinär schlägt vor, einfach weiterzufahren. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich überlege, was zu tun ist. Aus dem Auto hole ich die Seile und suche passende Holzstücke. Dann binden wir alles zusammen fest nach oben. Zuletzt schieben wir die Holzstücke dazwischen, damit die Seile nicht durchgeschabt werden. Langsam fahre ich weiter bis zu den ersten Manyattas. Dort laden wir vier der fünf Säcke aus und lagern sie in der erstbesten Hütte. Der Veterinär schärft den Leuten ein, die Säcke nicht zu öffnen. Vorsichtig fahren wir weiter nach Barsaloi. Ich rege mich so sehr über dieses verfluchte Fahrzeug auf, daß ich Magenschmerzen bekomme.