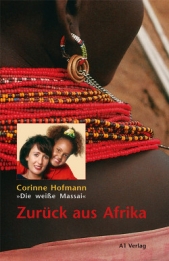Die weisse Massai
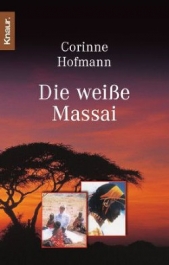
Die weisse Massai читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Die Abreise rückt näher. Meine gesamte Familie bespricht eine Kassette für Lketinga zu unserer Hochzeit. Deshalb muß auch noch ein kleines Radio-Kassettengerät in die Reisetasche. Mit zweiunddreißig Kilo Gepäck stehe ich am Flughafen Kloten zum Abflug bereit. Ich freue mich riesig auf die Heimreise. Ja, wenn ich in mein Innerstes horche, weiß ich jetzt, wo mein wirkliches Zuhause ist. Natürlich fäl t mir der Abschied von meiner Mutter schwer, doch mein Herz gehört bereits Afrika. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme.
Heimat Afrika
In Nairobi fahre ich mit einem Taxi zum Igbol-Hotel. Der Fahrer bemerkt den Massai-Schmuck an meinen Armen und fragt, ob ich die Massai gut kenne. „Yes, I go to marry a Samburu-man“,
ist meine Antwort. Der Driver schüttelt den Kopf und versteht anscheinend nicht, warum eine Weiße ausgerechnet einen Mann aus der, wie er es nennt, primitiven Volksgruppe heiraten will. Ich verzichte auf ein weiteres Gespräch und bin froh, endlich im Igbol angekommen zu sein. Doch heute habe ich kein Glück. Alle Zimmer sind besetzt. Ich suche nach einem anderen, günstigen Lodging und finde zwei Straßen weiter eine Möglichkeit.
Das Schleppen meiner Tasche bereitet mir trotz der kurzen Strecke enorme Mühe.
Dann muß ich noch drei Stockwerke hoch, bis ich in meinem Verschlag bin. Es ist bei weitem nicht so gemütlich wie im Igbol, und ich bin hier die einzige Weiße. Das Bett hängt durch, und unter dem Bettgestell liegen zwei gebrauchte Kondome.
Wenigstens sind die Bettlaken sauber. Ich gehe noch schnel ins Igbol, weil ich nach Maralal in die Mission telefonieren möchte. Von dort könnten sie morgen beim üblichen Radio-Funk in der Barsaloi-Mission melden, daß ich in zwei Tagen in Maralal eintreffe. Somit wüßte auch Lketinga von meiner Ankunft. Diese Idee kam mir im Flugzeug, und ich wil es ausprobieren, obwohl ich die Maralal-Missionare nicht kenne. Ob es gelingt, weiß ich nach dem Gespräch nicht. Mein Englisch ist besser geworden, doch gab es während des Gesprächs mehrere Mißverständnisse, denn der gute Missionar begriff meine Botschaft nur zögernd.
In der Nacht schlafe ich schlecht. Anscheinend bin ich in einem Stundenhotel der Einheimischen gelandet, denn links und rechts in den Räumen wird gequietscht, gestöhnt oder gelacht. Türen schlagen auf und zu. Aber auch diese Nacht geht vorüber.
Die Busfahrt nach Nyahururu verläuft ohne Hindernisse. Ich schaue aus dem Fenster und erfreue mich an der Landschaft. Mein Zuhause rückt immer näher. In Nyahururu regnet es, und es ist kalt. Ich muß noch einmal übernachten, bevor ich am nächsten Morgen den vergammelten Bus nach Maralal nehmen kann. Die Abfahrt verzögert sich um anderthalb Stunden, weil das Gepäck auf dem Busdach mit Plastikplanen zugedeckt werden muß. Auch meine große, schwarze Reisetasche befindet sich dort oben. Die kleinere behalte ich bei mir.
Nach der kurzen Asphaltstraße biegen wir in die Naturstraße ein. Aus rotem Staub ist rotbrauner Schlamm geworden. Der Bus fährt noch langsamer als sonst, um ja nicht in die großen Löcher zu geraten, die jetzt mit Wasser gefüllt sind. Er schlängelt sich vorwärts, steht manchmal fast quer und spult sich wieder auf die Fahrbahn. Wir werden die doppelte Fahrzeit benötigen. Die Straße wird immer schlimmer. Ab und zu steckt ein Fahrzeug im Schlamm fest, und verschiedene Menschen versuchen es wieder flott zu kriegen. Zum Teil liegt die Fahrspur dreißig Zentimeter tiefer als der Schlamm daneben. Durch die Fenster sieht man kaum etwas, so verspritzt sind sie.
Nach etwa der Hälfte der Strecke gerät der Bus ins Wanken und dreht mit dem Hinterteil so ab, daß er quer steht. Die hinteren Räder stecken im Straßengraben.
Nichts geht mehr, die Räder drehen durch. Zuerst müssen alle Männer raus. Der Bus rutscht zwei Meter zur Seite und steckt wieder fest. Nun müssen al e aussteigen.
Kaum habe ich den Bus verlassen, stecke ich bis zu den Knöcheln im Schlamm. Wir stehen auf einer erhöhten Wiese und beobachten die vergeblichen Bemühungen.
Viele, auch ich, schlagen Äste von den Büschen, die dann unter die Räder geschoben werden. Aber es nützt al es nichts. Der Bus steht immer noch quer.
Einige packen ihre Habseligkeiten und gehen zu Fuß weiter. Ich frage den Fahrer, was jetzt passiert. Er zuckt mit den Schultern und meint, wir müßten bis morgen warten. Viel eicht höre es auf zu regnen, dann trockne die Straße schnel.
Verzweifelt stecke ich wieder einmal mitten im Busch fest ohne Wasser und Eßwaren, nur mit Puddingpulver, das mir nichts nützt. Es wird schnell kalt, und ich friere in meinen nassen Sachen. Ich begebe mich wieder zu meinem Sitz.
Wenigstens habe ich eine warme Wol decke bei mir. Falls Lketinga die Nachricht überhaupt bekommen hat, wartet er jetzt vergebens in Maralal. Vereinzelt packen die Leute Eßbares aus. Jeder, der etwas hat, teilt es mit seinen Nachbarn. Auch mir werden Brot und Früchte angeboten. Ich nehme dankend, aber beschämt an, denn ich habe nichts anzubieten, obwohl ich am meisten Gepäck dabei habe. Alle richten sich im Sitzen zum Schlafen ein, so gut es geht. Die wenigen freien Plätze gehören den Frauen mit Kindern. In der Nacht kommt nur noch ein Landrover vorbei, der jedoch nicht hält.
Um etwa vier Uhr morgens ist es so kalt, daß der Chauffeur für fast eine Stunde den Motor laufen läßt, um zu heizen. Die Zeit schleicht dahin. Langsam färbt sich der Himmel rötlich, und die Sonne zeigt sich zögernd. Es ist kurz nach sechs. Die ersten verlassen den Bus, um ihre Notdurft hinter den Büschen zu verrichten. Auch ich steige aus und strecke meine steifen Glieder. Vor dem Bus ist es genauso schlammig wie tags zuvor. Wir müssen warten, bis die Sonne richtig scheint, dann wollen wir es noch mal probieren. Von zehn Uhr bis mittags wird geschoben und versucht, den Bus aus dem Graben zu fahren. Doch weiter als dreißig Meter kommt er nicht. Eine weitere Nacht hier draußen wäre schrecklich.
Plötzlich sehe ich einen weißen Landrover, der sich durch den Morast schlängelt und teils neben der Straße fährt. In meiner Verzweiflung renne ich auf den Wagen zu und stoppe ihn. In ihm sitzt ein älteres, englisches Paar. Ich erkläre kurz meine Situation und flehe die Leute an, mich mitzunehmen. Die Frau willigt sofort ein.
Freudig springe ich zum Bus und lasse mir meine Tasche herunterholen. Im Landrover hört sich die Lady entsetzt meine Geschichte an. Mitleidig hält sie mir ein Sandwich hin, das ich gierig verzehre.
Wir sind noch keinen Kilometer gefahren, als uns ein grauer Landrover entgegenkommt. Jetzt gilt es, höllisch aufzupassen, daß keiner der Wagen ins Schlängeln kommt, da die Straße sehr schmal ist. Wir fahren langsam, und der andere Wagen kommt schnel näher. Als er noch zwanzig Meter von uns entfernt ist, glaube ich, eine Fata Morgana zu sehen. „Stop, please, stop your car, this is my boyfriend!“
Am Steuer des Wagens sitzt Lketinga und fährt auf dieser Horrorstraße.
Wie verrückt winke ich aus dem Fenster, um auf mich aufmerksam zu machen, da Lketinga nur starr auf die Straße blickt. Ich weiß nicht, was größer ist: Meine riesige Freude und der Stolz auf ihn oder die Angst, wie er den Wagen zum Stehen bringen wird. Jetzt erkennt er mich und lacht uns stolz durch die Scheiben an. Nach etwa zwanzig Metern steht der Wagen. Ich stürze hinaus und renne zu Lketinga. Unser Wiedersehen ist phantastisch. Er hat sich besonders schön bemalt und geschmückt.
Ich kann meine Freudentränen kaum zurückhalten. Er hat zwei Begleiter bei sich und gibt mir freiwillig die Schlüssel, jetzt solle lieber ich zurückfahren. Wir holen mein Gepäck und laden um. Ich bedanke mich bei meinen Gastgebern, und der Engländer meint, jetzt verstehe er, bei so einem schönen Mann, warum ich hier sei.
Während der Rückfahrt erzählt Lketinga, daß er auf den Bus gewartet habe. Er hatte die Nachricht von Pater Giuliano erhalten und war sofort nach Maralal marschiert. Erst gegen zweiundzwanzig Uhr erfuhr er, daß der Bus steckengeblieben war und eine Weiße dabei sei. Als am Morgen der Bus wieder nicht kam, war er in die Garage gegangen, hatte unser repariertes Auto geholt und war einfach losgefahren, um seine Frau zu retten. Ich kann es nicht fassen, wie er das geschafft hat. Die Straße ist zwar ziemlich gerade, aber ganz und gar schlammig. Er fuhr alles im zweiten Gang und mußte ab und zu den abgestorbenen Motor wieder anlassen, aber sonst „hakuna matata, no problem“.