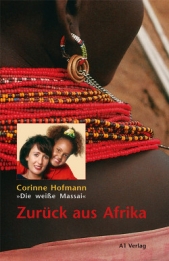Die weisse Massai
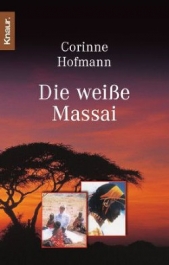
Die weisse Massai читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ich verrenne mich immer mehr in diese fixe Vorstel ung und beschließe, mit Lketinga, der mittlerweile ungeduldig und enttäuscht ist, ins nächste Reisebüro zu gehen und alles Notwendige zu erledigen. Wir treffen auf einen freundlichen Inder, der die Situation erfaßt und mich ermahnt aufzupassen, da viele weiße Frauen auf ähnliche Weise ihr Geld verloren hätten. Ich vereinbare mit ihm, uns eine Bestätigung über das Flugticket auszustellen, und deponiere das nötige Geld bei ihm. Er gibt mir eine Quittung und das Versprechen, mir den Betrag zurückzuerstatten, wenn es mit dem Paß nicht klappen sol te.
Irgendwie weiß ich, daß es waghalsig ist, aber ich verlasse mich auf meine gute Menschenkenntnis. Wichtig ist, daß Lketinga weiß, wo er hingehen kann, wenn er den Paß hat, um das Abflugdatum anzugeben. „Wieder einen Schritt weiter!“ denke ich kämpferisch.
Auf einem nahe gelegenen Markt kaufen wir für Lketinga Hosen, Hemd und Schuhe. Das ist nicht einfach, denn sein Geschmack und meiner sind sehr gegensätzlich. Er möchte rote oder weiße Hosen. Weiße, denke ich, sind im Busch unmöglich und rot ist nicht gerade eine „männliche“ Farbe für westliche Kleidung.
Das Schicksal kommt mir zu Hilfe, alle Hosen sind zu kurz für meinen Zweimetermann. Nach langem Suchen finden wir endlich Jeans, die passen. Bei den Schuhen fängt es wieder von vorne an. Er trug bis jetzt nur Sandalen, die aus alten Autoreifen gefertigt sind. Wir einigen uns auf Turnschuhe. Nach zwei Stunden ist er neu eingekleidet, und mir gefällt er trotzdem nicht. Sein Gang ist nicht mehr schwebend, sondern schleppend. Er allerdings ist richtig stolz, zum ersten Mal im Leben lange Hosen, ein Hemd und Turnschuhe zu besitzen.
Natürlich ist es zu spät, um noch mal zum Büro zu gehen, und so schlägt Lketinga vor, zur Nordküste zu fahren. Er will mir Freunde vorstellen und mir zeigen, wo er gewohnt hat, bevor er sich bei Priscilla einquartierte. Ich zögere noch, da es schon vier Uhr ist und wir dann in der Nacht zur Südküste zurück müßten. Wieder einmal sagt er: „No problem, Corinne!“
Also warten wir auf ein Matatu nach Norden, doch erst im dritten Bus finden wir ein winziges Plätzchen. Bereits nach wenigen Minuten läuft mir der Schweiß herunter.
Glücklicherweise erreichen wir bald ein wirklich großes Massai-Dorf, wo ich zum ersten Mal auf geschmückte Massai-Frauen treffe, die mich freudig begrüßen. Es ist ein Kommen und Gehen in den Hütten. Ich weiß nicht, staunen sie mehr über mich oder das neue Outfit von Lketinga. Alle begrapschen das hel e Hemd, die Hosen, und sogar die Schuhe werden bewundert. Die Farbe des Hemdes wird langsam, aber sicher dunkler. Zwei, drei Frauen versuchen gleichzeitig, auf mich einzureden, und ich sitze stumm lächelnd da und verstehe gar nichts.
Zwischendurch kommen wieder viele Kinder in die Hütte. Sie staunen oder kichern mich an. Mir fällt auf, wie schmutzig al e sind. Plötzlich sagt Lketinga: „Wait here“, und schon ist er weg. Mir ist nicht sehr wohl. Eine Frau bietet mir Milch an, die ich angesichts der Fliegen ablehne. Eine andere schenkt mir ein Massai-Armband, das ich freudig anziehe. Offensichtlich arbeiten alle an irgendwelchen Schmuckstücken.
Etwas später erscheint Lketinga wieder und fragt mich: „You hungry?“
Diesmal antworte ich ehrlich mit ja, denn ich habe wirklich Hunger. Wir gehen ins nahe gelegene Buschrestaurant, das ähnlich wie das in Ukunda ist, nur viel größer.
Hier gibt es eine Abteilung für Frauen und weiter hinten eine für die Männer. Ich muß natürlich zu den Frauen, und Lketinga verzieht sich zu den anderen Kriegern. Die Situation gefällt mir nicht, ich wäre lieber in meinem Hüttchen an der Südküste. Ich bekomme einen Teller vorgesetzt, in dem Fleisch und sogar einige Tomaten in einer saucenähnlichen Flüssigkeit schwimmen. Auf einem zweiten Teller liegt eine Art Fladen. Ich beobachte, wie eine andere Frau das gleiche „Menü“ vor sich hat und mit der rechten Hand den Fladen zerstückelt, dann in die Sauce tunkt, dazu noch ein Stück Fleisch nimmt und al es mit der Hand in den Mund schiebt. Ich mache es ihr nach, benötige jedoch dazu beide Hände. Augenblicklich wird es still, alle schauen mir beim Essen zu. Mir ist das peinlich, zumal zehn oder mehr Kinder um mich versammelt sind und mit großen Augen zusehen. Dann reden alle wieder durcheinander, und doch fühle ich mich weiter beobachtet. So schnell wie möglich schlinge ich al es herunter und hoffe, daß Lketinga bald wieder auftaucht. Als nur noch die Knochen übrig sind, gehe ich zu einer Art Faß, aus dem man Wasser schöpft und sich über die Hände schüttet, um sie vom Fett zu befreien, was natürlich illusorisch ist. Ich warte und warte, und endlich kommt Lketinga. Am liebsten würde ich ihm um den Hals fallen. Doch er schaut mich komisch, ja fast böse an, und ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht haben soll. Daß auch er gegessen hat, sehe ich an seinem Hemd. Er sagt: „Come, come!“
Auf dem Weg zur Straße frage ich: „Lketinga, what's the problem?“
Bei seinem Gesichtsausdruck wird mir bange. Daß ich der Grund für seine Verärgerung bin, erfahre ich, als er meine linke Hand nimmt und sagt: „This hand no good for food! No eat with this one!“
Ich verstehe zwar, was er sagt, aber weshalb er deswegen ein solches Gesicht macht, weiß ich nicht. Ich frage nach dem Grund, aber ich bekomme keine Antwort.
Ermüdet von den Strapazen und verunsichert durch dieses neue Rätsel, fühle ich mich unverstanden und möchte nach Hause in unser Häuschen an der Südküste.
Dies versuche ich Lketinga mitzuteilen, indem ich sage: „Let's go home!“
Er schaut mich an, wie weiß ich nicht, denn ich sehe wieder nur das Weiße der Augen und den leuchtenden Perlmuttknopf. „No“, sagt er, „all Massai go to Malindi tonight.“
Mir bleibt fast das Herz stehen. Wenn ich ihn richtig verstehe, will er tatsächlich wegen eines Tanzes heute noch weiter nach Malindi. „It's good business in Malindi“, höre ich. Er merkt, daß ich nicht sehr begeistert bin und fragt mich sofort in besorgtem Ton: „You are tired?“
Ja, müde bin ich. Wo genau Malindi liegt, weiß ich nicht, und Kleider zum Wechseln sind auch nicht hier. Er meint, kein Problem, ich könne bei den
„Massailadies“ schlafen, und morgen früh sei er wieder hier. Das macht mich wieder völlig wach. Hier bleiben, ohne ihn und ohne nur ein Wort sprechen zu können, diese Vorstellung erfüllt mich mit Panik. „No, we go to Malindi together“, beschließe ich. Lketinga lacht endlich wieder, und das vertraute „No problem!“
ertönt. Mit einigen anderen Massai steigen wir in einen öffentlichen Bus, der wirklich bequemer ist als diese halsbrecherischen Matatus. Wir sind in Malindi, als ich aufwache.
Als erstes suchen wir ein Einheimischen-Lodging, weil nach der Show wahrscheinlich al es ausgebucht sein wird. Viel Auswahl gibt es nicht. Wir finden eines, in dem sich bereits andere Massai einquartiert haben, und bekommen den letzten leeren Raum. Er ist nicht größer als drei mal drei Meter. An zwei Betonwänden steht ein Eisenbett mit dünnen, durchhängenden Matratzen und jeweils zwei Wolldecken darauf. Von der Decke hängt eine nackte Glühbirne herunter, und zwei Stühle stehen verloren im Raum. Wenigstens kostet es fast nichts, pro Nacht umgerechnet vier Franken. Uns bleibt gerade noch eine halbe Stunde Zeit, bevor die Vorführung der Massai-Tänzer beginnt. Ich gehe schnell eine Cola trinken.
Als ich kurz darauf in unser Zimmer zurückkomme, staune ich nicht schlecht.
Lketinga sitzt auf einem der durchhängenden Betten, die Jeanshose bis zu den Knien heruntergezogen und reißt ärgerlich daran herum. Offensichtlich wil er sie ausziehen, weil wir gleich los müssen und er natürlich nicht in europäischer Kleidung auftreten kann. Bei diesem Anblick kann ich nur mühsam mein Lachen unterdrücken.
Da er die Turnschuhe an hat, gelingt es ihm nicht, die Jeans darüberzuziehen. Nun hängt die Hose an seinen Beinen und geht weder rauf noch runter. Lachend knie ich nieder und versuche, die Schuhe wieder aus den Jeansbeinen herauszukriegen, wobei er schreit: „No, Corinne, out with this!“